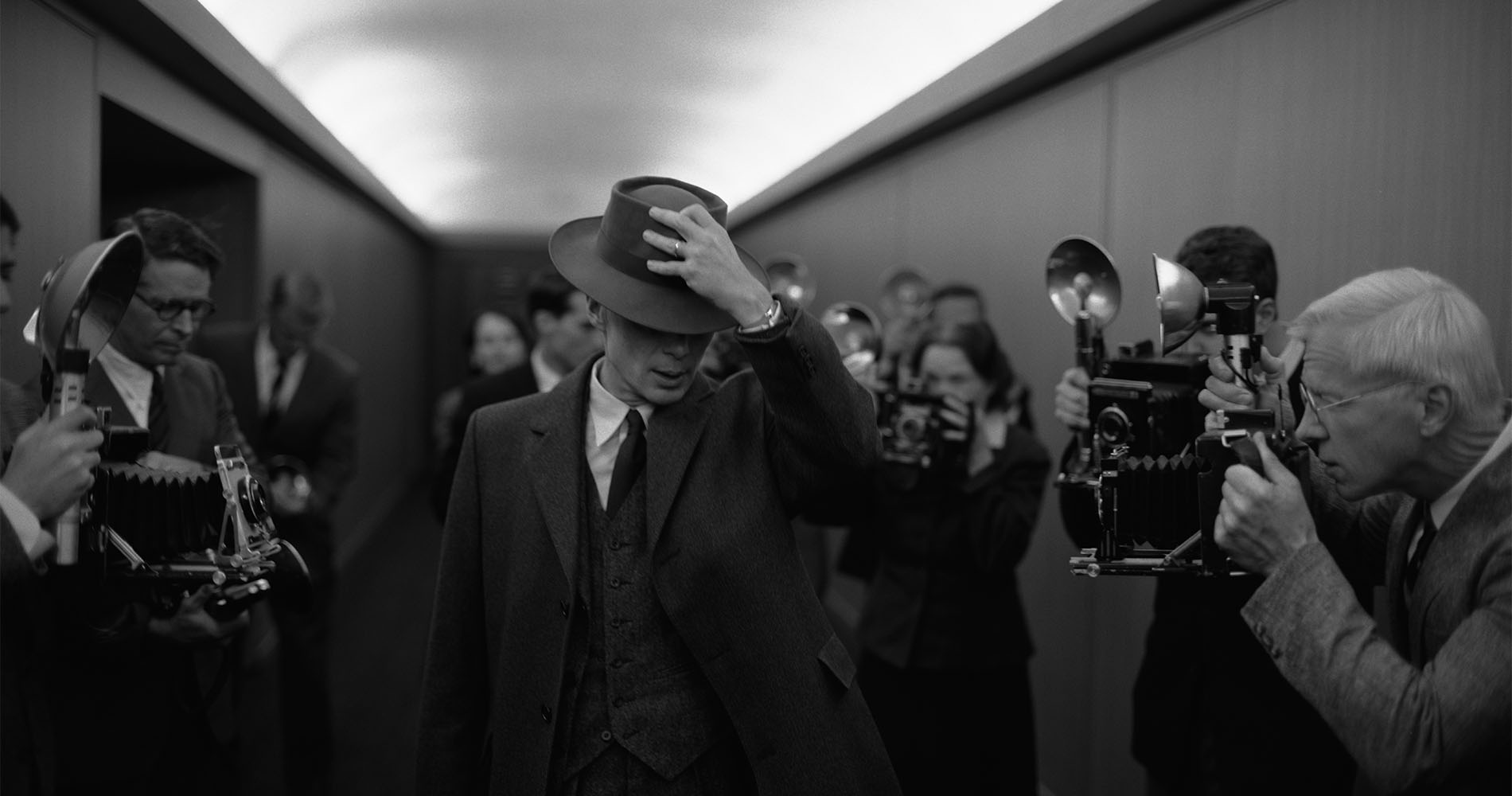Vom Schiff zum Fahrrad: Prekäre Logistik im Streik

Über prekäre Arbeit und gewerkschaftliche Organisierung am historischen Beispiel der Hafenarbeit – und warum das für heute Mut macht.
Prekär Beschäftigte können nur schwer für ihre Rechte kämpfen. Diese Binsenweisheit wird derzeit jedoch von einem potenziell bedeutsamen Beispiel untergraben: dem Streik beim Lebensmittellieferdienst Gorillas in Berlin. Während es Arbeiter:innen mit festen Beschäftigungsverhältnissen in „traditionellen“ Sektoren der Wirtschaft schwer fällt, in der Pandemie ihre potentielle Kampfkraft umzusetzen, weil die sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaftsapparate nach „nationaler Einheit“ streben, gehen die Rider bei Gorillas voran und streiken „wild“, das heißt inoffiziell, ohne Unterstützung oder Streikaufruf einer Gewerkschaft.
Die Arbeit bei Gorillas ist schlecht bezahlt, eine Ausbildung braucht es dafür nicht, viele der Beschäftigten sind erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Obwohl Gorillas sich damit rühmt, anders als Branchenkonkurrenten der Plattformökonomie (siehe dazu auch den Leitartikel dieses Magazins) feste Arbeitsverhältnisse anzubieten, sind viele der Rider in Wahrheit über Leiharbeitsfirmen angestellt. Gewerkschaftlich organisiert sind die wenigsten der Beschäftigten in diesem Sektor – was gleichwohl auch an einem Desinteresse der gewerkschaftlichen Apparate liegt. Simon Zamora Martin resümierte in der taz: „Aus ökonomischer Sicht lohnt sich ein Aufbau bei Gorillas für die großen Gewerkschaften wenig.“
Die heutigen Beschäftigten in der Plattformökonomie sind allerdings nicht die einzigen, bei denen große Hürden für gewerkschaftliche Organisierung mit großer Kampfbereitschaft zusammenfallen. Auf den naheliegenden Bezug zu inoffiziellen Streiks migrantischer Belegschaften nach 1968, wie etwa bei Pierburg in Neuss 1973, hat etwa Gerhard Hanloser im nd hingewiesen. Weniger augenfällig, dafür aber womöglich umso erhellender ist der historische Vergleich mit den Beschäftigten einer weiteren Branche: den Hafenarbeitern bis etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts.1
„Tagelöhnertum“ und „eine Art Sklavenhandel“
Häufig ist in der Diskussion um Beschäftigungsverhältnisse in der Plattformökonomie von „digitalem Tagelöhnertum“ die Rede. Stefan Lücking von der Hans-Böckler-Stiftung etwa machte 2019 besonders Lieferdienste aufgrund der Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten als „ein Beispiel für das neue Tagelöhnertum“ aus.2 Nicht selten wird dabei auf das 19. Jahrhundert verwiesen. Gleichwohl zogen sich solche unregelmäßigen Beschäftigungsverhältnisse – Moritz Altenried spricht hier von „einer sehr langen Geschichte informeller und kontingenter Arbeit“3 – noch weit bis in 20. Jahrhundert hinein.
Die Hafenarbeit ist hierfür wohl das Paradebeispiel. In vielen Staaten blieb die Beschäftigung an den Häfen bis in die 1950er Jahre „kontingent“, von Tagwerk zu Tagwerk. Ein Übergang zu geregelteren Arbeitsverhältnissen vollzog sich nur mit Brüchen, mal auf Bestreben der Beschäftigten selbst, mal gegen ihren Widerstand. Verhandelt werden diese Beschäftigungsverhältnisse unter den Begriffen unstetige bzw. unständige Arbeit (das Pendant im Englischen ist die Bezeichnung „casual labour“). Gleichzeitig gelten Hafenarbeiter in der Geschichte der Arbeiter:innenbewegung als einer der streikfreudigsten Sektoren der Arbeiter:innenklasse der Industriegesellschaften.
Zentrales Merkmal der Beschäftigungsverhältnisse an den Häfen war der „shape-up“, in den Worten Howard Zinns aus dessen Hauptwerk „A People’s History of the United States“ „einer Art frühmorgendlichen Sklavenhandels, in dem die Mannschaften für den Tag ausgewählt wurden“4. Auch wenn der Begriff des Sklavenhandels übertrieben scheinen mag, verweist Zinn damit auf eine zentrale Realität für viele Hafenarbeiter im 19. und 20. Jahrhundert an fast allen Häfen der Welt: Wenn sie Arbeit suchten, mussten sie dies jeden Tag aufs Neue tun und konnten sich nie sicher sein, auch Arbeit zu finden. Diese Organisation des Arbeitsmarktes lag zunächst vor allem im saisonalen Charakter der Schifffahrt bzw. der unregelmäßigen, zum Teil unvorhersehbaren Ankunft von Schiffen begründet, nachdem im 19. Jahrhundert sowohl die Volumina als auch die Anzahl der Schiffe stark gestiegen war und die alte Arbeitsorganisation in Gilden nicht mehr mit der Nachfrage Schritt halten konnte. Profitiert haben von dieser Arbeitsform natürlich die Kapitalist:innen.
1895 arbeiteten beispielsweise in Hamburg insgesamt rund 23.000 Arbeiter im Hafen, nur 5.800 von ihnen fanden jedoch auch nur einigermaßen regelmäßig Arbeit, d.h. mehr als 210 Tagwerke. Von ihnen wiederum waren wiederum etwa 1.000 nicht an der eigentlichen Hafenarbeit beteiligt, sondern führten Aufsichtstätigkeiten aus.5 Für die weit überwiegende Zahl der Beschäftigten musste die Hafenarbeit, ob sie wollten oder nicht, also ein Nebenerwerb bleiben – wenn auch ein einigermaßen einträglicher.
Zwar lagen die Löhne an den Häfen mancherorts höher als in anderen Branchen, die den Arbeitern offenstanden. Doch bezahlten sie diesen Vorzug mit einer großen Arbeitsbelastung, nahezu unbegrenzten Arbeitszeiten und daraus resultierenden häufigen Unfällen, die nicht selten tödlich ausgingen. Eine gewerkschaftliche Publikation beschrieb die Arbeit am Hamburger Hafen 1930 so:
Ungleichmäßig im Schiffsraum verteilt, suchen die Schauerleute möglichst schnell die Hieve fertigzustellen. Schlingen, Ketten werden mit Schiffsgütern vollgepackt. Nur nicht umsehen, sonst muß der Aufzugshaken warten und dann gibt es mit Schichtende bestimmt Ausscheiden. Keine Zeit zum Aufsehen, immer Rhythmus, Schaffen, Schaffen, rin und raus, so geht es Tag für Tag. Mit monotoner Stimme singt der Decksmann seinen Warnungsvers – Kiek ut oder Wahrschau oder Unnerut –, dann ein Signal an den Mann an der Schiffswinde und gleich einem Wirbelwind taucht die Hieve am Lukenrand auf… Immer Hast immer Schaffen, Tons um Tons werden in einem Tempo geladen oder gelöscht, wie man es nicht für möglich halten würde.6
Formal galten die allermeisten Hafenarbeiter als un- beziehungsweise angelernt. Tatsächlich aber erforderte der Umgang mit den vielen verschiedenen Gütern vor der Einführung von standardisierten Containern besondere Fähigkeiten, große Erfahrung und insbesondere Vertrauen zu den Kollegen. Deutlich wurde dies etwa, als 1949 die britische Labour-Regierung einen wochenlangen Streik der Hafenarbeiter brechen wollte, indem sie Soldaten einsetzte, um die vorenthaltene Arbeitskraft zu ersetzen. Zwar gelang es der Regierung letztlich, den Streik zu beenden, unter anderem indem sie die Streikenden in einer großen öffentlichen Kampagne diskreditierte. Die mit der Hafenarbeit nicht vertrauten Soldaten hatten sich zuvor jedoch als recht ineffizienter Ersatz erwiesen.
Die potenzielle Kampfkraft der Hafenarbeiter liegt, wie allgemein im Logistiksektor, in ihrer zentralen Rolle für die kapitalistische Warenzirkulation begründet, durch die sie eine besondere strategische Position einnehmen können. Woher stammte jedoch die bemerkenswerte Bereitschaft vieler Hafenarbeiter – über nationale Grenzen hinweg –, in den Kampf zu treten? Zum einen brauchten sie vergleichsweise wenig Angst vor einer Entlassung zu haben, schließlich war der Wechsel des Arbeitgebers ohnehin in kurzen Abständen nötig. Eine wirkliche Gefahr bestand lediglich darin, seine Registrierung als Hafenarbeiter zu verlieren und überhaupt nicht mehr im Hafen beschäftigt werden zu können. Dass sie so häufig den Arbeitsplatz wechseln mussten, brachte auch einen unmittelbaren Zeitdruck mit sich: Kam ein Missstand zur Sprache, musste eine Aktion dagegen erfolgen, noch bevor der aktuelle Auftrag erfüllt war. Aus solchen spontanen Momenten des Widerstands vonseiten nur einer Handvoll von Arbeitern konnte unter Umständen rasch ein großer Ausstand resultieren. Der wochenlange Streik tausender Arbeiter im Londoner Hafen 1948 nahm seinen Anfang beispielsweise mit der Forderung einer einzelnen Gang, eine Schiffsladung Zinkoxid nur zu löschen, wenn sie einen Gefahrenzuschlag erhielten.
Hinzu kam der kollektive Charakter der Arbeit in den Gangs, die in der Regel etwa acht bis zehn Mann umfassten. Trotz des unregelmäßigen Charakters der Arbeit kannten sich die Arbeiter untereinander gut und bestanden mitunter darauf, gemeinsam beschäftigt zu werden. Auch die Wohnsituation in hafennahen Vierteln wie in Hamburg oder sogar in speziellen unternehmenseigenen Wohnheimen wie im Südafrika der Apartheid sorgten für eine enge Verbindung der Arbeiter und ihres sozialen Umfelds auch außerhalb des Hafens. Nicht zuletzt lag die Militanz der Hafenarbeit auch in ihrer kosmopolitischen Natur begründet. Viele Hafenarbeiter waren zuvor selbst zur See gefahren und lernten im Austausch mit Kolleg:innen aus aller Welt neue politische Ideen und Aktionsformen kennen.
Sich der geforderten Arbeitsdisziplin zu widersetzen, musste jedoch nicht unmittelbar bedeuten, in den Streik zu treten. Es konnte auch heißen, kleinere Mengen an Lebensmitteln zu entwenden und vor Ort zu verzehren oder unbemerkt einen Laderaum so zu bestücken, dass hinter den gestapelten Gütern Freiräume blieben, um damit früher Feierabend machen zu können.
Tatsächlich besitzt sogar das Wort „Streik“ selbst eine maritime Herkunft. 1768 strichen in einem Akt der Sabotage englische Seeleute die Segel ihrer Schiffe (engl. strike the sails), um gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu protestieren und das Auslaufen der Schiffe zu verhindern. Noch im selben Jahr wurde es in England auch auf andere Arbeitsniederlegungen außerhalb des Hafens übertragen. Anfang des 19. Jahrhunderts gelangte die Bezeichnung dann als Lehnwort ins Deutsche und fand auch in zahlreiche weitere europäische Sprachen Eingang.
Den großen reformistischen Gewerkschaften, in der Weimarer Republik etwa dem sozialdemokratischen Deutschen Transportarbeiter-Verband, fiel es trotz der strategischen Bedeutung des Sektors schwer, die Hafenarbeiter zu organisieren. Besonders diejenigen in unregelmäßigen Beschäftigungsverhältnissen tendierten, wenn sie sich organisierten, eher zu lokal verankerten kommunistischen oder syndikalistischen Organisationen. Gleichzeitig forderten sie von den national agierenden sozialdemokratischen Gewerkschaften, für sie mit den Unternehmen zu verhandeln.
Die Spontaneität der Streiks bedeutete, dass sie in aller Regel als „wilde“ Streiks begannen. Wenn sie sich ausbreiteten, konnten sie jedoch auch die Unterstützung der Gewerkschaften finden. Nichtsdestoweniger war die Selbstorganisierung der Basis im Hafen in vielen der Streiks von großer Bedeutung. In England nahmen in der Organisierung der Streiks die shop stewards, also von den Beschäftigten gewählte Gewerkschaftsdelegierte, zentrale Rollen ein. Dabei gerieten sie als Vertreter der Basis schnell in Konflikte mit den von der Gewerkschaftsführung eingesetzten Sekretären, die den Beschäftigten selbst fernstanden.
Maßgeblich aus den Reihen der shop stewards bildeten sich in den Kämpfen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an mehreren Häfen inoffizielle Streikkomitees, die auch in ruhigen Phasen eine gewisse organisatorische Kontinuität wahren konnten. Im bereits erwähnten Streik in London 1948 bildete das inoffizielle Streikkomitee den direkten Widerpart zur eng mit der Labour-Regierung verbundenen Führung der Transport and General Workers‘ Union (TGWU), die um jeden Preis den Streik ihrer eigenen Basis abwürgen wollte. Eine zentrale Rolle spielten in dieser Auseinandersetzung Versammlungen aller Streikenden, die über den Fortgang des Kampfes abstimmten. In einem Fall hielten die TGWU-Führung und das Streikkomitee sogar parallele Versammlungen ab, was bedeutete, dass bereits die Teilnahme an der einen oder anderen Versammlung einer demokratischen Entscheidung der Arbeiter für oder gegen den Streik gleichkam – die Kundgebung der Bürokratie blieb deutlich kleiner und der Streik ging weiter.
Das ungleiche Ende der Unregelmäßigkeit
Wo reguläre Linien verkehrten, zeigten einige Unternehmen bereits früh ein Interesse an einer „Decasualisation“, allerdings gelangte hierbei nur ein gewisser Teil der Arbeiter in feste Arbeitsverhältnisse. Auch nachdem bereits 1906 in Hamburg oder 1919 in Bremen unterschiedliche Statusgruppen geschaffen worden waren, blieb ein großer Teil der Beschäftigten als eine Art Reservearmee unregelmäßig beschäftigt. In der Regel wurden dabei drei Gruppen geschaffen: ein Kern mit nahezu sicherer Anstellung und Bezahlung, eine zweite Gruppe, die täglich am Hafen antreten musste, deren Beschäftigung jedoch nicht gesichert war, sowie eine dritte Gruppe, die nur bei sehr hoher Nachfrage nach Arbeitskraft angefragt wurde.
Neben der Abwehr von Streiks und Unruhen bildeten auch sozialmoralische Vorstellungen einen wichtigen Antrieb, die unstetige Arbeit zurückzudrängen. Nicht ganz zu Unrecht galten dem Staat die unständig Beschäftigten als wenig zuverlässig und potenziell aufsässig. Die „Decasualisation“ war demnach ein bewusster Vorstoß zur Disziplinierung. Die Arbeiter waren hiervon vielerorts wenig begeistert. Für sie ging damit ein Verlust an Autonomie einher, selbst zu wählen, wann und mit wem sie arbeiten wollten. Vielerorts nahm der Staat als „dritter Sozialpartner“ die entscheidende Rolle bei der „Decasualisation“ ein. Er musste dabei oft nicht nur den Widerstand der Arbeiter, sondern auch den der betroffenen Unternehmen überwinden, die ihre Flexibilität bedroht sahen. In der Nachkriegszeit bezogen auch kapitalistische Staaten wie das Vereinigte Königreich die Autorität für solche Maßnahmen aus den bereits erfolgten staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft während des Krieges.
In den imperialistischen Zentren waren die Häfen einer der letzten Orte, wo geregelte Beschäftigungsverhältnisse Einzug hielten. In den afrikanischen Kolonien etwa Großbritanniens hingegen machte die „Decasualisation“ aus den Häfen Inseln fester Beschäftigungsverhältnisse umgeben von „casual labour“ in den anderen Bereichen der Wirtschaft. Standen in Mombasa 1944 nur 900 monatlich fest beschäftigte Hafenarbeiter 5.000 unregelmäßig beschäftigten gegenüber, lag dieses Verhältnis 1959 bei 4.400 zu 1.000.7 Besonders in den ehemaligen Kolonien blieb die Einführung fester Beschäftigungsverhältnisse keineswegs ein linearer Prozess. So kam es etwa in Südafrika im Verlauf der 1980er Jahre zu einer „Recasualisation“ eines Teils der Beschäftigten, als neue Unternehmen auf den Markt drängten.
Allerdings war nicht ausgemacht, dass die Aufhebung der unregelmäßigen Beschäftigungsformen zu einem Machtzuwachs der Unternehmerseite oder zunehmender staatlicher Disziplinierung führen musste. 1934 kam es an der US-Westküste zu einem epochemachenden Streik der Hafenarbeiter, der gemeinsam mit dem Transportarbeiterstreik in Minneapolis und dem Auto-Lite-Streik in Toledo zum Aufstieg der US-amerikanischen Industriegewerkschaften Mitte der 1930er Jahre führte. In diesem hart umkämpften Streik gelang es den Hafenarbeitern letztlich, neben einer Lohnerhöhung und dem Sechs-Stunden-Tag auch die Kontrolle über die Arbeitszuteilung zu erringen – um mit dem US-Historiker Peter Cole zu sprechen, eine „‚Decasualisation‘ von unten“8. Fortan wurde in einer „hiring hall“ der im Streik entstandenen International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union (ILWU)9 nach dem Prinzip „low man out“ die Arbeit verteilt. Das hieß, dass derjenige gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, der am längsten ohne Arbeit war, den Job bekam. Die Arbeiter behielten auf diese Weise die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann sie sich um Arbeit bemühen wollten und gewannen dazu ein gewisses Maß an Sicherheit. Vor allem bedeutete es, dass die Docker nicht mehr der Willkür und Bestechlichkeit der Vorarbeiter ausgeliefert waren, die zuvor die Gangs ausgewählt hatten. Eine ganz ähnliche Regelung wurde in Hamburg bereits um 1920 eingeführt – im unmittelbaren Nachgang der deutschen Revolution schien es, „als ob der Arbeitsplatz, der Arbeitsmarkt und die Hafenbezirke unter der direkten und alleinigen Kontrolle der Hafenarbeiter standen.“ Die Unternehmen aber waren nicht tatsächlich entmachtet worden und so gelang es ihnen bereits 1923 in der Hyperinflation und mit dem endgültigen Ende des revolutionären Prozesses in Deutschland den egalitären Modus der Arbeitszuteilung wieder abzuschaffen.
Die Einführung geregelter Beschäftigungsverhältnisse ging international nicht einheitlich vonstatten. Während es erste Ansätze dazu in Hamburg schon Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hatte, brachte erst die Containerisierung eine internationale Synchronisierung der Beschäftigungsverhältnisse mit sich. Sie verringerte den Bedarf an Arbeitskraft massiv, was die Kampfkraft der Gewerkschaften schmälerte, und schloss mit der technischen Spezialisierung der Arbeit eine Beschäftigung von Gelegenheitsarbeitern weitgehend aus. Die Errungenschaften der ILWU erodierten dabei im Laufe der 1960er Jahre, ein ausdauernder Streik der überwältigenden Mehrheit der Hafenarbeiter in der Bay Area um San Francisco konnte 1971 das Ruder nicht mehr herumreißen.
Und nun?
Die Ähnlichkeiten zwischen den Hafenarbeitern der Mitte des 20. Jahrhunderts mit den Prekären der Plattformökonomie – der Gelegenheitscharakter der Arbeit, die Schwierigkeiten der gewerkschaftlichen Organisierung, die Spontaneität und der selbstorganisierte Charakter der Aktionen – sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es freilich mannigfaltige Unterschiede gibt. Insbesondere die Stellung im Produktionsprozess und damit die Schlagkraft, die ein Streik gesamtgesellschaftlich erzeugen kann, ist ein großer Unterschied zwischen beiden Bereichen, mit wichtigen Konsequenzen für die Kampfkraft der Arbeiter:innen. Denn während die Hafenarbeiter mit ihrem Streik nicht nur die Häfen, sondern gesamte Industrien und Lieferketten lahmlegen konnten, vermögen die Plattformarbeiter:innen erst einmal „nur“ die Profite der jeweiligen Kapitalist:innen anzugreifen. Doch auch hier darf die symbolische Ausstrahlung ihrer Aktionen nicht unterschätzt werden.
Vor allem hilft der Blick auf die Hafenarbeit als Beispiel einer noch lange anhaltenden Form kontingenter Arbeit dabei, heutige Debatten um die angebliche Neuartigkeit der Arbeitsverhältnisse in der Plattformökonomie historisch einzuordnen. Derartigen Thesen liegt die implizite Vorstellung zugrunde, dass das tariflich geregelte, unbefristete Normalarbeitsverhältnis in Vollzeit im Kapitalismus die Norm sei. Langfristig wird jedoch ebenso wie in der Untersuchung spezifischer Branchen wie der Hafenarbeit deutlich, dass diese Form der Anstellung sowohl geografisch als auch zeitlich eine Ausnahme in der Geschichte des Kapitalismus darstellt.
Gleichzeitig weisen die Beispiele der ILWU an der US-Westküste oder der scheinbaren Arbeiter:innenkontrolle über den Hamburger Hafen nach dem Ersten Weltkrieg auf ein grundlegendes Merkmal von Klassenkämpfen im Kapitalismus. Sie zeigen, dass es möglich ist, Errungenschaften innerhalb des Kapitalismus zu erkämpfen und der antagonistischen Klasse der Kapitalist:innen vorübergehend sogar einen Teil ihrer Kontrolle über die eigene Arbeit abzutrotzen. Sie zeigen jedoch ebenso, dass solche Errungenschaften im Kapitalismus nicht von Dauer sein können. Die nächste technologische Neuerung oder ein Abflauen eines revolutionären Prozesses können ihre Grundlage jederzeit untergraben.
Das zentrale Problem, das sich den Hafenarbeitern damals ebenso stellte wie heute den Beschäftigten der Plattformökonomie, besteht also darin, aus den Kämpfen heraus ein Werkzeug zu schaffen, das dazu geeignet ist, den Kapitalismus ein für alle Mal zu zertrümmern und eine Gesellschaftsordnung zu erkämpfen, in der einmal erkämpfte Errungenschaften nicht mehr rückgängig gemacht werden können: den Sozialismus.
Fußnoten
1 Die Hafenarbeit war lange Zeit eine nahezu rein männliche Domäne, Frauen waren bis weit ins 20. Jahrhundert, also auch im Vergleichszeitraum, lediglich als Angestellte in der Verwaltung beschäftigt. Das bedeutet freilich nicht, dass Fragen des Geschlechts keine Rolle gespielt hätten. Vielmehr bildete ihre Männlichkeit für viele Hafenarbeiter einen konstitutiven Bestandteil ihrer Identität als Arbeiter.
2 Stefan Lücking: Arbeiten in der Plattformökonomie. Über digitale Tagelöhner, algorithmisches Management und die Folgen für die Arbeitswelt, Düsseldorf 2019.
3 Moritz Altenried: Was ist eine Plattform? Politische Ökonomie und Arbeit im Plattformkapitalismus, in: Ders., Julia Dück und Mira Wallis (Hg.): Plattformkapitalismus und die Krise der sozialen Reproduktion, Münster 2021, S. 50-69, hier S. 65.
4 Howard Zinn: Eine Geschichte des Amerikanischen Volkes. Band 6: Reformen, Repressionen und der Erste Weltkrieg. Aus dem amerikanischen Englisch von Sonja Bonin, Berlin 2006, S. 137.
5 Michael Grüttner: Arbeitswelt an der Wasserkante. Sozialgeschichte der Hamburger Hafenarbeiter, 1886-1914, Göttingen 1984, S. 32.
6 Zit. nach Klaus Weinhauer: Unfallentwicklung und Arbeitsprozeß im Hamburger Hafen 1986/97-1936, in: Karl Lauschke und Thomas Welskopp (Hg.): Mikropolitik im Unternehmen. Arbeitsbeziehungen und Machtstrukturen in industriellen Großbetrieben des 20. Jahrhunderts, Essen 1994, S. 107-122, hier S. 115.
7 Lex Heerma van Voss: „Nothing to Lose but a Harsh and Miserable Life Here on Earth”. Dock Work as a Global Occupation, 1790-1970, in: Jan Lucassen (Hg.): Global Labour History. A State of the Art, S. 591-621, hier S. 615.
8 Peter Cole: Dockworker Power. Race and Activism in Durban and the San Francisco Bay Area, Urbana, Chicago und Springfield 2018, S. 120.
9 Heute heißt die Gewerkschaft International Longshore & Warehouse Union, um der geänderten Geschlechterzusammensetzung der Mitgliedschaft Rechnung zu tragen.