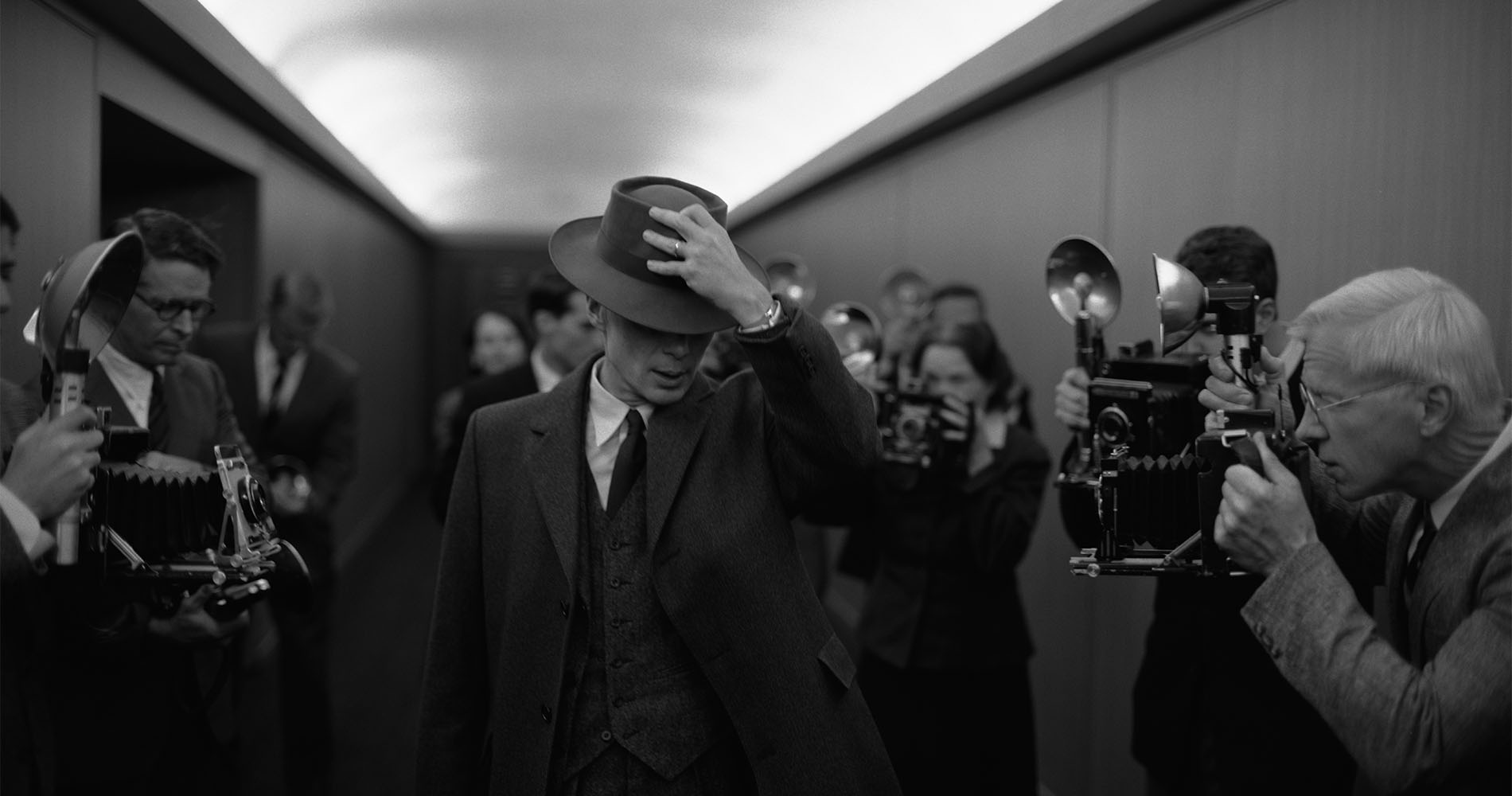Marxismus und Monogamie: Wie haben die Menschen im Urkommunismus gevögelt?

Die Reaktion behauptet gern, monogame Zweierbeziehungen seien etwas „natürliches“ für die Menschen. Aber ist das wirklich so? Ein jetzt auf Deutsch erschienenes Buch räumt gründlich mit dem Mythos der ewigen Monogamie auf.
Unser Bild vom Leben in der Steinzeit ist stärker von Fred Feuerstein geprägt, als wir gern zugeben würden. Niemand glaubt, dass die Menschen vor Zehntausenden von Jahren kleine Dinosaurier als Staubsauger benutzten. Aber wir sehen Fred, Betty und Pebbles in ihrem Einfamilienhaus – als ob die bürgerliche Kleinfamilie, sauber getrennt von der Nachbarsfamilie, etwas Selbstverständliches wäre.
Monogame Beziehungen entsprechen einer „menschlichen Natur“ – das wird gern von der Reaktion behauptet. Dazu kommen auch pseudowissenschaftliche Theorien: Männer seien dazu programmiert, ihre Samen möglichst weit zu streuen, während Frauen dazu bestimmt sind, nach einem einzigen, treuen Ehemann und Versorger zu suchen.
Doch Monogamie ist eine ausgesprochene Seltenheit in der Tierwelt. Nur wenige Arten wie Pinguine, Gibbons oder Albatrosse bilden Zweierbeziehung. Aber neuere Forschung zeigt, dass auch diese angeblich monogamen Tiere nicht weniger Seitensprünge machen als angeblich monogame Menschen.
Wie haben unsere Vorfahren vor der Entstehung der Klassengesellschaft gevögelt? Die Frühgeschichte der Menschheit spielte sich in Clans ab. Ist es vorstellbar, dass Menschen in solchen Clans nur mit jeweils einem einzigen Partner Sex hatten? Werden sich nur die biologischen Eltern um den Nachwuchs gekümmert haben?
Sex at Dawn
In ihrem Buch suchen Christopher Ryan und Cacilda Jethá, zwei Psycholog*innen aus Barcelona, nach Erklärungen für die Evolution der unendlich komplexen menschlichen Sexualität. „Sex at Dawn“ („Sex – die wahre Geschichte“) greift auf Primatologie, Anthropologie und Evolutionsbiologie zurück – und weist nach, dass Monogamie ein recht neues und alles andere als natürliches Sexualverhalten für den Menschen darstellt.
Die Vorstellung von Zweierbeziehungen in der Steinzeit kritisieren die Autoren als „Fred-Feuerstein-Verfälschung“ (Flinstonization) der Frühgeschichte. Sie wollen stattdessen „echte Fakten“ sammeln. Die Suche läuft auf verschiedenen Wegen:
1. Wir können unsere nächsten Verwandte in der Tierwelt angucken.
Bei Primaten kommt sehr unterschiedliches Sexualverhalten vor. Schimpansen und Bonobos – mit denen wir einen gemeinsamen Vorfahren vor fünf Millionen Jahren hatten – leben in Clans. Besonders bei letzteren gibt es „ungezügelten Gruppensex (…), der für allgemeine Entspannung sorgt und das komplexe soziale Netz stabilisiert“. Bonobos pflegen so viel sexuellen Kontakt miteinander, dass Primatolog*innen von einem „Bonobo-Händeschütteln“ sprechen, wenn sie sich gegenseitig masturbieren.
Gorillas, viel entfernter mit uns verwandt, leben in Gruppen mit einem einzigen Alphamännchen und mehreren Weibchen. Der Silberrücken hält andere Männchen von seinem Harem fern. Dagegen können Schimpansenweibchen „Dutzende Male am Tag Geschlechtsverkehr mit allen willigen Männern haben“. Mit letzteren sind wir viel näher verwandt, was sich auch in unserer Körperstruktur ausdrückt.
2. Wir können Gesellschaften ohne soziale Klassen heute angucken.
In entlegenen Teilen der Welt leben heute noch Gruppen von Menschen ohne Privateigentum und ohne sozialen Klassen. Diese indigenen Gesellschaften sind so weit von sexueller Monogamie entfernt, dass sie nicht mal eine Vorstellung davon besitzen, dass Babys von einem einzelnen Mann abstammen. Stattdessen gehen sie davon aus, dass eine Frau, während sie Sex mit praktisch allen Männern des Clans hat, immer mehr Sperma in ihrem Bauch sammelt, bis daraus ein Fötus entsteht. So setzen sich die einzelnen Teile des Kindes von unterschiedlichen Vätern zusammen – und die Kinder gehören dem gesamten Dorf.
3. Wir können unsere eigenen Körper angucken.
Ein bestimmtes Sexualverhalten prägt nach Millionen Jahren die physischen Formen einer Spezies. Denn jeder Organismus optimiert seinen Energieverbrauch, um die eigenen Gene weiterzugeben. Am menschlichen Körper lassen sich verschiedene Merkmale einer langen Tradition von Gruppensex erkennen. Ein Beispiel sind unsere Genitalien:
Ein männlicher Gorilla sichert die Weitergabe der eigenen Genen dadurch, dass er andere Männchen von seinen Weibchen fern hält. Entsprechend investiert sein Körper in einen breiten Brustkorb und starke Armen – dafür hat er relativ kleine Hoden. Bei Bonobos dagegen konkurrieren die Männer nicht um den Zugang zu den Frauen. Alle haben Sex miteinander – und die Spermien der verschiedenen Männer konkurrieren innerhalb der Vagina. Entsprechend investieren männliche Schimpansen ihre Energie in große Hoden. Der Gorilla ist etwa viermal größer als der Bonobo, und dennoch sind seine Hoden nur ein Drittel so groß. Und auch hier sind Menschen viel näher an den Bonobos als an den Gorillas.
Unnatürliche Sexualität
Das sind nur drei Beispiele aus einem vierhundertseitigen Band. Das Buch greift genauso modernen Pornokonsum auf, um zu zeigen, dass Menschen nach viel mehr als monogamen Beziehungen verlangen. Der US-Kolumnist Dan Savage fragt, warum so viele Religionen Abweichungen von der Monogamie so hart bestrafen, wenn das das natürliche Verhalten unserer Spezies sein soll.
Aber wie sieht wirklich natürliche Sexualität aus? Sollen Sozialist*innen fordern, dass wir in Gruppen von etwa 50 Menschen aller Altersgruppen und Geschlechter leben, die ununterbrochen miteinander Sex haben?
Nein. Diese Untersuchung zeigt, dass Sexualität zwar ein biologisches Fundament hat, aber von der Gesellschaft ständig neu geformt wird. Heutige Menschen haben sexuelle Bedürfnisse, die im Urkommunismus gar nicht vorstellbar waren. Wie könnten Menschen, die keinerlei Formen von Herrschaft kannten, das Spielen mit Dominanz und Unterwerfung erotisch finden?
Eine sozialistische Forderung wäre nach einer freien Sexualität: In monogamen Zweierbeziehungen, in großen Clans oder in ganz anderen Konstellationen. Aber eine solche Freiheit steht im Widerspruch zur bürgerlichen Gesellschaft, die auf die Kleinfamilie – wie bei den Feuersteins – als Reproduktions- und Konsumeinheit basiert.
Marxismus
Über weite Strecken haben sich Marxismus und Anthropologie Hand in Hand entwickelt. Deswegen haben Ryan und Jethá mehr Übereinstimmungen mit marxistischen Ideen, als ihnen vermutlich bewusst ist. So betonen sie, dass der Zwang zur weiblichen Monogamie – und allgemeiner das Patriarchat – zusammen mit dem Ackerbau und dem Privateigentum entstanden ist. Und wiederholen, was Friedrich Engels bereits im 19. Jahrhundert postulierte.
Die Autor*innen zeichnen nach, dass sich menschliche Sexualität zusammen mit den gesellschaftlichen Verhältnissen stets entwickelt. Doch sie verkennen die zentrale Rolle des Klassenkampfes in der Geschichte. Deswegen legen sie auch kein politisches Programm gegen den Zwang zur Monogamie vor. Aufklärung über Bonobos ist faszinierend, und dennoch nicht ausreichend, um eine wirklich freie Sexualität zu erreichen.
Denn erst jene Menschen, die nicht mehr gezwungen werden, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, können ihre Bedürfnisse – sexuelle und andere – frei ausleben. Bis dahin sind Menschen, und vor allem weibliche Menschen – selbst wenn sie dieses Buch gut studieren – durch endlose materielle Zwänge in Bezug auf Sex und Beziehungen eingeschränkt.
Für die kapitalistische Reproduktion werden Frauen doppelt und dreifach ausgebeutet. Und alle Menschen, die von der heterosexuellen Norm abweichen, werden vielfältig bestraft. Der Kampf für eine freie Sexualität bedeutet nicht wirklich eine Rückkehr zu den Bonobos oder eine Rückkehr zum menschlichen Urkommunismus. Es ist ein ein Kampf gegen die bürgerliche Gesellschaft und für die Enteignung der Produktionsmittel.
Christopher Ryan, Cacilda Jethá: „Sex. Die wahre Geschichte“. Stuttgart 2016. 430 Seiten. 24,95 Euro.