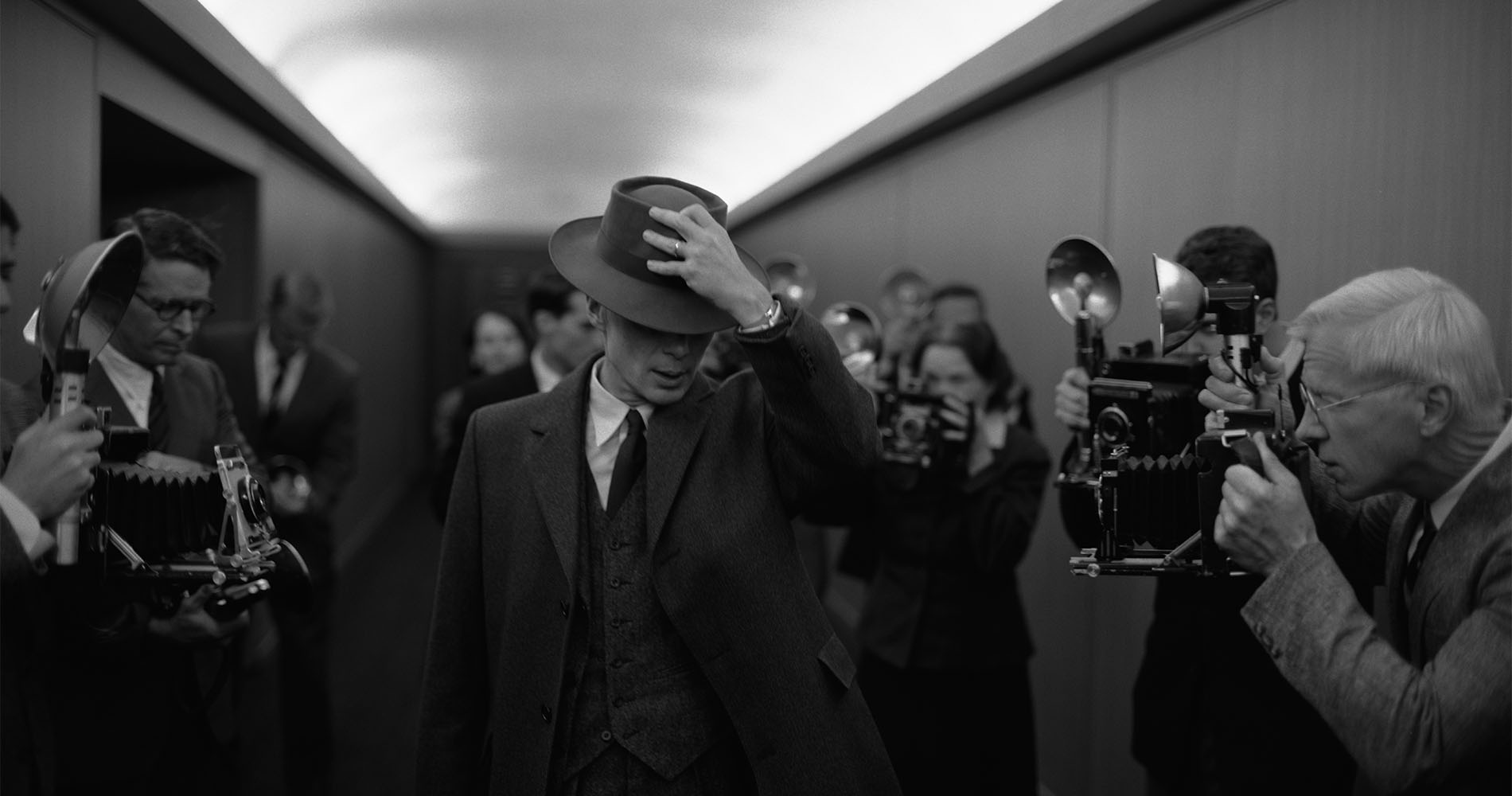Suizidalität im Kapitalismus: Für eine Umkehrung der Beweislast!
Warum der Liberalismus auf die Frage des Suizids keine guten Antworten findet. Ein Debattenbeitrag von David Doell.
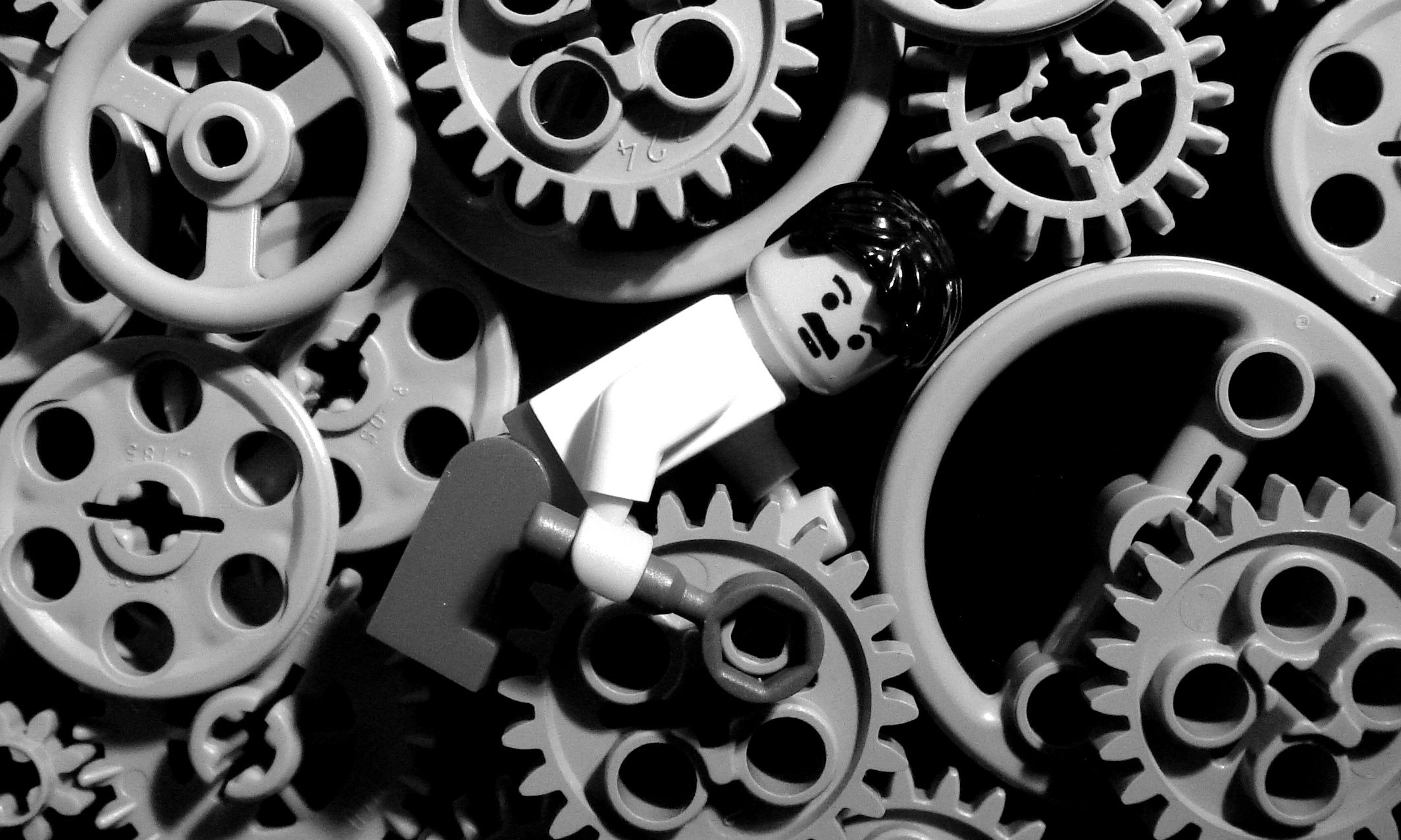
Die massive Wirklichkeit der Suizide in unserer Gesellschaft konfrontiert aber auch die Fernstehenden mit der Ahnung es könne um diese Gesellschaft nicht zum Besten bestellt sein, wenn so viele Menschen bereit sind, total mit ihr zu brechen – um den Preis ihres Lebens (Kettner/Gerisch, Zwischen Tabu und Verstehen, Psycho-philosophische Bemerkungen zum Suizid, 2004)
In seinen Vorlesungen über Ethik begründet Kant das absolute moralische Verbot, sich zu töten, wesentlich damit, dass wer Selbstmord versuche, sich selbst zu einem „Objekt“ mache, diese Verdinglichung einer Person aber grundsätzlich nicht zustehe. Sein zweites Argument lautet, dass jede „Natur“ versucht sich zu erhalten und dass, wer bereit sei, „sich selbst zu zerstören“, sich zum „Meister“ über sein Leben – und damit auch über das Leben aller Anderen – mache. Wer diese ‚Meister*innenschaft’ erlange, dem steht nach Kant auch die Türen zu allem anderen moralischen Fehlverhalten offen, denn „ehe man ihn habhaft werden kann, ist er [sic!] bereit, sich aus der Welt wegzustehlen.“ Der Bruch mit der Selbsterhaltung impliziert nach Kant auch einen Bruch mit jeglicher Moralität oder Ethik. Sein abschließendes Urteil lautet: „Wir sehen einen Selbstmörder als ein Aas an.“ Paradigmatisch führt Kant damit einige liberale Diskursverknappungen vor: Die* Einzelne* existiert als Gegebene, verdinglicht sich in einem autark-souveränen Akt, widerspricht „der“ Natur, wird deswegen zu einer Gefahr für „die“ Gesellschaft und ist als moralisch schlecht anzusehen.
Gerisch/Kettner verfolgen in ihrer Auseinandersetzung mit Suizidalität Kants ‚Argumente’ im Register des Respekts vor der Freiheit personaler Selbstbestimmung, widerlegen sie im Einzelnen und kommen zu der Überzeugung, dass der wohl eigentlich wichtigste Grund für die philosophische Ächtung des Selbstmords in seiner Unheimlichkeit liegt, mit dem Prinzip der Selbsterhaltung zu brechen. Ich denke, dass dieser „Bruch mit der Selbsterhaltung“ kein ‚Bruch an sich’ mit „der“ „Natur“ ist, sondern ein immer je spezifischer Bruch mit einer bestimmen gesellschaftlich-geschichtlichen Formation. Oder um es thesenhaft zu sagen, kann, wer heute von Selbstmord sprechen will, (natürlich) vom Kapitalismus nicht schweigen. Gegen Kant gilt es zu sagen, dass es die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, welche die Menschen grundlegend verdinglicht und gerade nicht der Suizid, der als Verzweiflungstat auch versucht gerade diesen Verhältnissen zu entkommen.
Die Verdinglichung der ‚Natur’
Interessanterweise liegt in Kants Argumenten dann ein herrschaftskritischer Anteil, wenn unter anderen Vorzeichen über Verdinglichung und Naturbeherrschung nachgedacht wird. Denn es ist gerade diese gesellschaftliche Formation des Kapitalismus, die Natur und Menschen in einer bisher unbekannten Weise verdinglicht, kommodifiziert und ausbeutet. Es ist damit viel eher die kapitalistische Lebensform, welche sich zur „Meisterin“ über Natur und Menschen macht, die bereit ist zu ihrer Selbsterhaltung alles andere zu zerstören, als der einzelne Mensch, der sein Leben in dieser Formation beendet.
Nicht zufällig steht die Menschheit mit der drohenden Klimakatastrophe zum ersten Mal davor die Erde so tiefgreifend zu zerstören, dass zu Frage steht, ob sie für Menschen überhaupt noch bewohnbar sein wird. Wie Mark Fisher gesagt hat, können wir uns heute das Ende der Welt viel eher vorstellen, als das Ende des Kapitalismus bzw. das Ende unserer gesellschaftlich-geschichtlichen Lebensform. Nach meinem Eindruck bleibt der Zusammenhang zwischen Naturbeherrschung und gesellschaftlicher Herrschaft oft unterreflektiert – was sich darin ausdrückt, dass Klimakämpfe teilweise abgetrennt werden von Kämpfen gegen kapitalistische Produktionsweisen und Verdinglichungen. Diese Tendenz durchzieht möglicherweise auch marxistischen Diskurse als Folge einer übermäßigen Fortschritts- und Technikgläubigkeit im 19. Jahrhundert. Demgegenüber insistieren Adorno/Horkheimer nach den katastrophischen Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die unhintergehbare Verflochtenheit zwischen Selbst- und Fremdverhältnissen, Naturbeherrschung und gesellschaftlicher Herrschaft. Gerade „die Unterwerfung alles Natürlichen unter das selbstherrliche Subjekt“ gipfelt zuletzt „in der Herrschaft des blind Objektiven, Natürlichen“ (T. Adorno/G. Adorno/Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, 1944). Denn „die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität, die einerseits die Bedingungen für eine gerechtere Welt herstellt, verleiht andererseits dem technischen Apparat und den sozialen Gruppen, die über ihn verfügen, eine unmäßige Überlegenheit über den Rest der Bevölkerung.
Der Einzelne wird gegenüber den ökonomischen Mächten vollends annulliert. Dabei treiben diese die Gewalt der Gesellschaft über die Natur auf nie geahnte Höhe.“ (ebd.) In der Rede der „Alternativlosigkeit“ von Thatcher bis Merkel im politischen Diskurs zeigt sich die Aktualität des Theorems, die Naturalisierung von Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen als Ausdruck der Dialektik zwischen selbstherrlichem Subjekt und Herrschaft des blind Objektiven. Die Folge – und das ist das wesentliche – ist die vermittelte Selbstverdinglichung der Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft.
Die Verdinglichung der ‚Anderen’
Im Konkreten lässt sich dieser Gedankengang momentan beispielsweise auch an der Theorie und Praxis im Umgang mit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ verdeutlichen. Zunächst muss einfach gesagt werden, dass eine Gesellschaft moralisch am Ende ist, wenn sie von einer „Flüchtlingskrise“ spricht, damit aber wesentlich nicht das Massensterben im Mittelmeer meint, sondern das Ankommen von vor Krieg und Elend fliehenden Menschen. Was sich viel eher zeigt als eine „Krise wegen der Geflüchteten“ ist eine „Krise des Humanitären“, eine Tragödie in Syrien und eine todernste Farce im Mittelmeer – und Tendenzen einer Implosion der liberalen Ideologie des kapitalistischen Westens.
Die Erschütterungen sind bis weit ins Lager der politischen Linken spürbar: nicht nur bei denen, die offen einen sozial-nationalen Kurs propagieren, um vermeintlich prekarisierte Arbeiter*innenmilieus anzusprechen, bei denen sie tatsächlich schon lange vorher große Stimmenverluste der Linkspartei gab. Sondern auch da, wo der „Wir schaffen das“-Slogan unkritisch übernommen wird, beziehungsweise der Dualismus zwischen strukturellem Rassismus liberaler Akteur*innen und dem in Teilen offen faschistischen Rassismus rechter Akteur*innen lediglich reproduziert wird, anstatt einen eigenständigen linken, antirassistisch-revolutionären Antagonismus zu Staat und Kapital zu formulieren.
Zentral unterstützt wurde die „Wir schaffen das“-Position einerseits von Kapitalfraktionen, die sich angesichts des demographischen Trends niedrigen Bevölkerungswachstums in der BRD eine Lösung von „Arbeitskraftproblemen“ versprachen:
Über 60 Prozent der deutschen Manager*innen glaubten, ihre Unternehmen würden durch eine schnelle Integration der Geflüchteten profitieren (SZ, 24.9.2015 ). BDI-Präsident Ulrich Grillo erklärte: “Wir haben ein demografisches Problem in der Zukunft. Das heißt, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften. Dieser Mangel kann reduziert werden.“
Die Offenheit, mit der die humanitäre Katastrophe von Akteur*innen der Kapitalfraktionen als Chance für die Sicherstellung der Profitraten des Produktionsstandorts angesehen wird, kann dabei in keinem Fall mehr schockieren, als der EU-Türkei-Deal, mit dem die deutsche Regierung die sogenannte „Willkommenskultur“ des „Wir schaffen das“ außenpolitisch ausbuchstabiert hat. Die sechs Milliarden Euro, die bis 2018 an die protofaschistische Regierung in Ankara gezahlt werden sollen, können im Wortsinn als Blutgeld verstanden werden, wenn türkische Soldaten im Sinne der EU-Grenzregime an der türkisch-syrischen Grenze flüchtende Menschen erschießen, darunter auch Kinder.
Die Verdinglichung der Anderen findet in der unter anderem vom deutschen Staat erkauften mörderischen Gewalt der Grenzsoldaten, wo im wahrsten Sinne menschliche Leben durch Mordwaffen in Dinge (Leichname) verwandelt werden, einen Höhepunkt.
Die Verdinglichung des ‚Selbst’
Ich denke, dass diese Objektivierung, was im Extremfall Sterben-Lassen und Ermorden bedeutet, nicht nur auf die „Anderen“ wirkt, sondern gleichzeitig den Charakter unserer Gesellschaft im Ganzen zeigt. Silvia Federici hat in „Caliban und die Hexe“ herausgestellt, dass Prozesse der Kolonialisierung und Verdinglichung von (proletarischen) Frauen-Körpern konstitutiv für den modernen Kapitalismus sind. Diese sexistischen und rassistischen Prozesse verdinglichen und kommodifizieren aber nicht nur Allmende, Frauen und kolonialisierte Subjekte, ‚die Anderen’, sondern vermittelt das ganze, vom Produkt seiner Arbeit und von seiner Umgebung ebenfalls entfremdete westliche Proletariat – auch wenn diesem im globalen Reproduktionszusammenhang eine andere Stellung zukommt.
Bei allen Unterschieden reduzieren sowohl „Obergrenzen“, die über das Leben und Sterben von Menschen entscheiden, als auch Lohnkosten als Zahlen, die über die Lohnarbeitsverhältnisse und Existenzweisen von Menschen entscheiden, komplexe soziale Beziehungen auf ein individuiiertes Ding. Neben der Ausbeutung der Arbeitskraft ist es gerade diese Verdinglichung und Kommodifizierung, welche der modernen kapitalistischen Gesellschaft zu Grunde liegt: Sie haben wesentlich Anteil am „Erfolg“ des kapitalistischen Westens für seine Kapitalist*innen und sind der verschleierte und verdrängte Preis unserer Lebensform (ähnlich argumentieren Brand/Wissen in Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus, 2017).
Nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts und dem Ende des Glaubens an einen inhärenten Fortschritt der Geschichte sind Massenkonsum und Sicherheit im Prinzip die letzten zentralen Versprechen und ‚Werte’ der westlichen Gesellschaften. Beides wird im Grunde und kontinuierlich durch das Leiden von subalternisierten Person gewährleistet, was in den Peripherien weniger und in den westlichen Metropolen mehr verschleiert wird.
Auch in der Krisen-Gewinnerin BRD gibt es beispielsweise über vier Millionen depressive Personen, schätzungsweise versucht sich alle fünf Minuten eine Person das Leben zu nehmen. Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ führte uns zuletzt intensiv vor Augen, wie es um die kapitalistische Welt insgesamt steht. Das verdrängte schlechte Gewissen, an den Ausbeutungsraten in der Peripherie und den Waffenlieferungen dahin zu profitieren, wird von den Flucht- und Migrationsbewegungen auf die Tagesordnung gesetzt. Der Rassismus von Staat und Kapital wird deswegen im Alltagsverstand teilweise auch durch eine Abwehr und Verweigerung ergänzt, sich wirklich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und der strukturellen Gewalt der globalisierten Welt auseinanderzusetzen.
Ich denke, dass jede zur Empathie auch nur ansatzweise fähige Person, die wirklich über globalen Reproduktionsverhältnissen nachdenkt und zum Beispiel die Zufälligkeit anerkannt, mit der du je Geburtsort ausgebeutet, verdinglicht und auf der Flucht vor Elend und Krieg erschossen wirst, zur Schlussfolgerung gelangen kann, dass es um diese Gesellschaft nicht gut steht. Und ich denke, dass das sogar von einer liberalen Perspektive der Menschenrechte aus einsichtig sein kann: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, aber überall wird sie mit Füßen getreten, wie Rousseau vielleicht gesagt hätte.
Für eine Umkehrung der „Beweislast“
Ich denke also, nicht die Person, die ihr Leben beenden will, verdinglicht sich wesentlich selbst darin, sondern diese Gesellschaft als solche verdinglicht grundlegend die in ihr lebenden Menschen. Ein Suizid ist damit schließlich auch ein Ausdruck des Wunsches nach einer Negation dieser Verdinglichung und kann im foucault’schen Sinne als eine Praxis des „nicht mehr so regiert werden Wollens“ verstanden werden, nämlich nicht mehr auf diese Weise und um diesen Preis Teil dieser Gesellschaft sein zu wollen. Ein Suizid als Verzweiflungstat wie beispielsweise die Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi in Tunesien, kann zwar keine sinnvolle Strategie der politischen Linken sein, aber die Tat selbst kann eben dennoch als politische Artikulation verstanden werden, nicht mehr so regiert werden zu wollen. Die gesellschaftliche Verdinglichung bleibt mit einem Suizid bestehen, und sogar der Suizid selbst kann im Nachhinein Teil davon werden. Wie Benjamin in seiner VI. Geschichtsthese sagt, sind auch die Toten (und ihre Tode, Weisen des Sterbens), vor dem Feind (der hegemonialen Deutung) nicht sicher. Die Verdinglichung wird schließlich nur durch ihre Bedingungen in der Produktion und der ganzen gesellschaftlichen Organisierung mit ihrem mannigfaltigen Unterdrückungsmechanismen und Ideologien der Entfremdung nachhaltig aufgehoben, nicht mit dem Ende eines Lebens.
Der Suizid ist also zwar keine Aufhebung, doch ein Ausdruck der Verdinglichung, der nach seiner Negation zielen kann. Das Problem ist nicht eine Person, die sich suizidiert, sondern die sie verdinglichenden Umstände, von denen sie sich befreien möchte. Anders gesagt, ich denke, dass die „Beweislast“ des Suizids vom Individuum auf die Gesellschaft umgekehrt werden kann. Dass nämlich wesentlich nicht die Person, die ihr Leben beenden will, Gründe für ihre Selbstverdinglichung im Selbstmord angeben muss, sondern die Gesellschaft viel eher rechtfertigen muss, warum sie die in ihr lebenden Menschen in dieser Weise „regiert“, verdinglicht, kommodifiziert, entfremdet, ausbeutet – sodass sich diese selbst suizidieren.
***
Das zweite der kantischen Argumente knüpft insofern an als erste an, als es die Selbstverdinglichung zu Ende denkt und dabei zu dem Schluss kommt, dass wer zum Selbstmord bereit ist – also mit der dem spezifisch Menschlichen schon gebrochen hat – auch zu jeglicher Form des Verbrechens und amoralischen Verhalten fähig ist. Wie ich versucht habe zu zeigen, stellt sich aus einer gesellschaftskritischen Perspektive der Kontext dieser Prämisse als äußerst problematisch dar: Eine Person, die ihr in Leben in dieser Gesellschaft aufgeben will, hat nicht notwendig mit allem Menschlichen, Werten und Sozialität überhaupt gebrochen. Viel mehr kann es diesen Personen als revolutionären Kommunist*innen ja zum Beispiel gerade um ganze andere, solidarischere Institutionen, Beziehungsweisen, Reproduktionsweisen gehen.
Ich denke, dass es beispielsweise einen ontologischen Unterschied zwischen einem Selbstmord und einem Mord an einer anderen Person gibt. Dass eine Person, die ihr Leben wegen dauerhaften Leiderfahrungen und Schmerzen selbst beendet, unendlich weit davon entfernt sein kann, anderen Menschen Schmerzen oder Leiderfahrungen zuzufügen zu wollen. Das eigentlich Tragische eines Suizids scheint mir persönlich sogar darin zu liegen, gerade die Menschen zu verletzen, die wir am meisten mögen und denen wir auch politisch am Nächsten stehen. Wenn wir uns auch in unserem Bestreben uns zu suizidieren als Kommunist*innen erst nehmen – der Suizid kein rein privates Problem von Einzelnen ist –, stehen wir meines Erachtens viel weniger vor einem moralischen als vor ethisch-politischen Problem. Dass wir nämlich in Bezug auf unseren Suizid als gemeinsame Entscheidung einen fundamentalen Interessenkonflikt mit unseren Freund*innen und Genoss*innen austragen müssen. Castoriadis analysiert dieses Problem der ethischen Unentscheidbarkeit anhand von Sophokles Antigone und stellt die Verse 707-709 als zentrale Textpassage der griechischen Tragödie und Gesellschaft heraus:
Denn wer meint, der einzige zu sein, der beurteilen kann, oder eine Seele oder eine Redegabe zu haben wie kein anderer von solchen Leuten, wird man sehen, wenn man sie öffnet sind sie leer. (Anthropogenie bei Aischylos und Selbstschöpfung des Menschen bei Sophokles, 2011)
Antigone und Kreon sind in der ihnen je eigenen Weise davon überzeugt, die einzige Person zu sein, „die beurteilen kann“, und schließlich nicht in der Lage die Position der Anderen anzuerkennen. Für mich ist es gerade eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten überhaupt, nicht „alleine Recht haben zu wollen“, und die Positionen von Anderen auch im ernsthaften Konfliktfall anerkennen zu können. Das ist nicht nur die Grundlage für die Austragung des politischen Konflikts an sich, sondern auch die Bedingung der Möglichkeit, Anderen in ihrem Anderssein – und jenseits ihrer sozialen Positionierung – nahe zu kommen und sich selbst zu verändern. Daraus lässt sich vielleicht die leicht widersprüchliche These gewinnen, dass ein Selbstmord zwar nicht moralisch verwerflich ist und sich in dieser Gesellschaft die herrschende Klasse vor den Suizidant*innen und ihren Angehörigen gerechtfertigten sollte (und nicht umgekehrt). Dass „wir“ aber andererseits doch in einer bestimmten Weise mit unserem Freund*innen/Genoss*innen in einen ethisch-politischen Konflikt eintreten sollten, auch wenn es bei einem Selbstmord um eine der scheinbar privatesten Entscheidungen überhaupt geht.