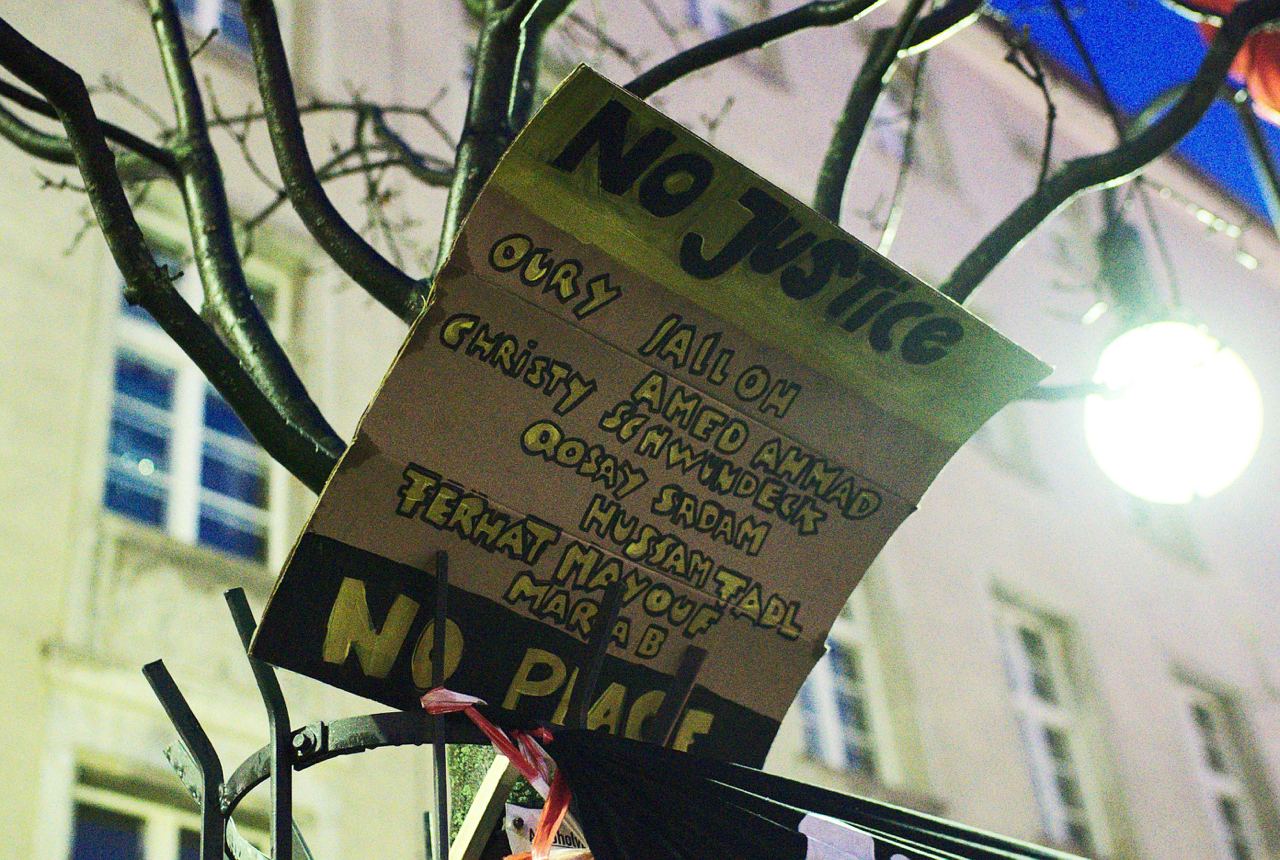Piketty: Größer als Marx?

Eine Kritik des neuesten Buches des wohl derzeit bekanntesten französischen Ökonomen.
Der französische Ökonom Thomas Piketty war 2014 überall – The Economist nannte ihn „größer als Marx“, und es wurden sogar schon T-Shirts mit der Aufschrift „r>g“, der zentralen „Erklärung“ Pikettys für die wachsenden Ungleichheiten des heutigen Kapitalismus gesichtet. Woher kommt der Erfolg seines Buchs „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ und was bedeutet es für Linke?
Piketty wird auch von Linken dafür gelobt, das Thema Ungleichheit der Vermögen und Einkommen (dazu später mehr) mit seinem Bestseller ins Zentrum der Debatte gerückt zu haben. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass dieses Buch progressiv wäre, sondern zeigt vielmehr deutlich auf, wie reaktionär die meisten bürgerlichen Ökonom*innen eigentlich sind. In einer Welt, in der die krasse ökonomische Ungleichheit für jede*n offensichtlich ist, bewegen sie sich in einer Phantasiewelt, in der Ungleichheit nur als spezielle Sonderannahme eine Rolle spielt, von der sofort wieder abstrahiert werden kann, sobald es zu schwierig zu rechnen wäre.
In der bürgerlichen Ökonomie wird zumeist von einem „repräsentativen Haushalt“ ausgegangen – ein ökonomischer Akteur, der seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, konsumiert und einen Anteil am Gesamtkapitalstock der Volkswirtschaft besitzt. Dieser Haushalt optimiert seinen Nutzen, d.h. er wählt die Menge an Arbeit, seinen Konsum und den Anteil seines Vermögens und Einkommens, den er investiert statt zu konsumieren, so, dass es für ihn am besten erscheint. Weiter gehen Ökonom*innen dann davon aus, dass eine Volkswirtschaft aus einer großen Anzahl dieser Haushalte besteht – und dass diese alle gleich sind. D.h. es reicht, einen “repräsentativen” von ihnen zu betrachten, um die grundlegenden Dynamiken der Volkswirtschaft zu verstehen.
In dieser Welt wird kein Unterschied gemacht zwischen Arbeiter*innen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen oder Kapitalist*innen, die Besitzer*innen der Produktionsmittel sind. Jede*r ist beides gleichermaßen und so gibt es auch keinen Konflikt zwischen denen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und jenen, die diese ausbeuten, um Mehrwert zu produzieren. Ungleichheit wird als vorübergehendes Phänomen bei der Entwicklung einer Volkswirtschaft verstanden (Kuznet) oder es wird darüber gestritten, wie sie exakt zu beziffern sei – ohne auf die grundlegenden Mechanismen einzugehen, die sie erzeugen.
Mit diesem Mainstream bricht nun Piketty scheinbar in seinem Bestseller und wird dafür gefeiert. Dass er damit nicht alleine da steht und alles andere als radikal ist, fällt unter den Tisch. Denn auch Piketty ist letztendlich ein bürgerlicher Ökonom und Reformist. Nicht umsonst stellt er seinem Werk ein Zitat aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte aus der französischen Revolution voran. Sein Werk ist ein Versuch, den Kapitalismus, der seit der Wirtschafts- und Finanzkrise in einer Legitimationskrise steckt, zu retten. Deshalb auch seine Schlussfolgerungen und Forderungen, die auf eine „gerechtere“ Verteilung innerhalb des Kapitalismus durch Steuern und Regulierung abzielen.
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ besteht aus drei Teilen: Einer empirischen Analyse, einem theoretischen Erklärungsversuch und Politikempfehlungen. Pikettys stärkstes Argument ist die Empirie. Auf einer Datenbasis, die rund 250 Jahre und mehr als 20 Länder umfasst, weist er nach, dass die Ungleichheit der Einkommen (dabei sind Einkommen aus Arbeit und aus dem Besitz an Kapital für ihn das gleiche) mit Ausnahme eines kurzen Einbruchs von Anfang des Ersten bis Ende des Zweiten Weltkrieges immer weiter zugenommen hat. Das heißt, diejenigen mit hohen Einkommen erhalten einen immer größeren Teil des Gesamteinkommens.
Dabei zeigt er auch auf, dass die Zusammensetzung der Einkommen unterschiedlich ist, je nachdem an welchem Ende der Einkommensskala ein Mensch sich befindet: Wenn sie*er viel verdient, dann machen die Kapitaleinkommen den Großteil aus, wenn sie*er wenig verdient, dann spielen diese praktisch keine Rolle. Dies sollte eigentlich für ihn ein Hinweis sein, dass diese beiden Formen der Einkommen nicht einfach so gleichzusetzen sind. Denn dadurch beraubt er sich die Möglichkeit, die fundamentalen Unterschiede zwischen ihnen zu verstehen. Für ihn sind Kapital und Arbeit einfach gleichwertige „Produktionsfaktoren“, die gemeinsam Waren und Dienstleistungen produzieren und nach ihrer Produktivität bezahlt werden.
Und auch die Ungleichheit der Vermögen ist laut Pikettys empirischer Analyse – mit Ausnahme der (Zwischen-)Kriegszeit – immer weiter gewachsen. Gerade die Daten über Vermögensbestände sind ein wichtiger empirischer Beitrag, weil (private) Vermögen nur sehr schwer und selten statistisch erhoben werden können, anders als Einkommen, die ja besteuert und deshalb gemessen werden. Vermögen und Kapital setzt Piketty dabei in seiner Analyse gleich und definiert sie als „alle Vermögensarten, die Menschen gehören und von ihnen weitergegeben oder dauerhaft auf einem Markt getauscht werden können“. Darunter fällt dann Finanzkapital, Immobilien ebenso wie Produktionsmittel wie Maschinen oder ähnliches – ohne genau zu erläutern, wie diese verschiedenen Arten des „Kapitals“ zusammengehören und was ihnen gemeinsam ist.
Für ein Werk, das sich „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ nennt, beschäftigt es sich nämlich erstaunlich wenig mit der Frage, was Kapital eigentlich ist und wie es dazu kommt, dass es wächst. Piketty ist weit davon entfernt, Kapital wie Marx als ein soziales Verhältnis zu verstehen – und damit auch nicht in seiner Prozesshaftigkeit, geschweige denn den Kapitalismus als historisch bestimmtes Produktionssystem zu sehen, das überwunden werden kann. Bei Marx ist Kapital „prozessierender Wert“, das heißt es macht verschiedene Metamorphosen durch und wird dadurch zum Kapital. Eine dieser Metamorphosen ist der Eintritt in den Produktionsprozess, wo es in Form von Produktionsmitteln auftritt und das die Ware Arbeitskraft kauft.
Für diese Ware müssen die Kapitalist*innen einen Lohn zahlen, der niedriger ist, als der Wert, den die Arbeiter*innen mit ihrer Arbeitskraft schaffen. Aus der Ausbeutung der Arbeiter*innen entsteht also der Mehrwert, den sich die*der Kapitalist*in aneignen und wieder als Kapital akkumulieren kann. Piketty betrachtet den Produktionsprozess, in dem Kapital sich ständig verwertet, nicht und kann dadurch auch die grundlegende Funktionsweise des Kapitalismus nicht erkennen. Piketty erliegt dem schon von Marx beschriebenen Kapitalfetisch: dem Anschein, dass Kapital aus sich selbst heraus wächst, ohne zu betrachten, dass das nur geschieht, weil es in den Produktionsprozess eintritt und hier Mehrwert produziert wird – und zwar durch menschliche Arbeitskraft.
Und auch seine Erklärung der Ungleichheit ist im Grunde keine Erklärung. Er argumentiert, dass die Einkommensungleichheit wächst, sobald die Kapitalrendite r größer als die Wachstumsrate g ist (also sobald r>g). Unter der Kapitalrendite versteht er den „durchschnittlichen Kapitalertrag eines Jahres in Form von Gewinnen, Dividenden, Zinsen, Mieten und anderen Kapitaleinkommen“. Die Wachstumsrate beschreibt er als das Wachstum der Produktion in einer Volkswirtschaft und damit als Wachstum der Einkommen (denn alles was produziert und verkauft wird, wird entweder in Form von Kapitalerträgen ausgeschüttet, in Produktionsmittel reinvestiert oder in Form von Löhnen ausgezahlt).
Wenn r>g, bedeutet dies, dass die Ungleichheit der Einkommen immer weiter zunimmt, sobald Vermögen ungleich konzentriert sind. Historisch hat diese Ungleichung seinen Berechnungen nach immer gegolten. Und dies ist auch kein Wunder, denn der allergrößte Teil der Kapitalakkumulation findet im Verwertungsprozess des Kapitals selber statt – nur sehr wenige können so viel aus ihren Arbeitseinkommen sparen, um daraus Kapital zu machen.
Pikettys Erklärung der Ungleichheit ist eigentlich eine statistische Beobachtung, die beispielsweise nichts darüber aussagt, warum die Kapitalrendite einen bestimmten Wert hat, wie die Höhe der Löhne zustande kommt, usw. Es ist eine vollständig unpolitische Betrachtungsweise, die die ständigen Klassenauseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit außen vor lässt. Er führt immer wieder den technischen Fortschritt als Begründung an, ohne dabei die inneren Beweggründe der Einzelkapitalist*innen zu analysieren – Fortschritt kommt bei ihm von außen, losgelöst vom Produktionssystem selber.
Piketty ist weder ein Linker, noch reichen seine Analysen aus. Aber seine Datenbasis ist ein Schatz, der von Marxist*innen genutzt werden muss. Die Daten sind frei zugänglich und auch wenn sie sicherlich mit Vorsicht zu genießen sind – zum Beispiel weil sie auf der Grundlage von bürgerlichen ökonomischen Kategorien erhoben wurden, die nicht so einfach eins zu eins in marxistische zu übersetzen sind – dürfen wir ihre Interpretation nicht einfach den Retter*innen des Kapitalismus überlassen.
In der Tendenz des Kapitalismus, mehr Ungleichheit zu erzeugen, sieht Piketty den „zentralen Widerspruch des Kapitalismus“ – ein Widerspruch also, der für ihn durch Regulierung und Besteuerung überwunden werden kann. Doch der zentrale Widerspruch des Kapitalismus ist der zwischen Arbeiter*innenklasse und Bourgeoisie: Denn Arbeiter*innen und Kapitalist*innen haben antagonistische Klasseninteressen, die nur überwunden werden können, wenn wir das System selber stürzen und die Kapitalist*innen enteignen.