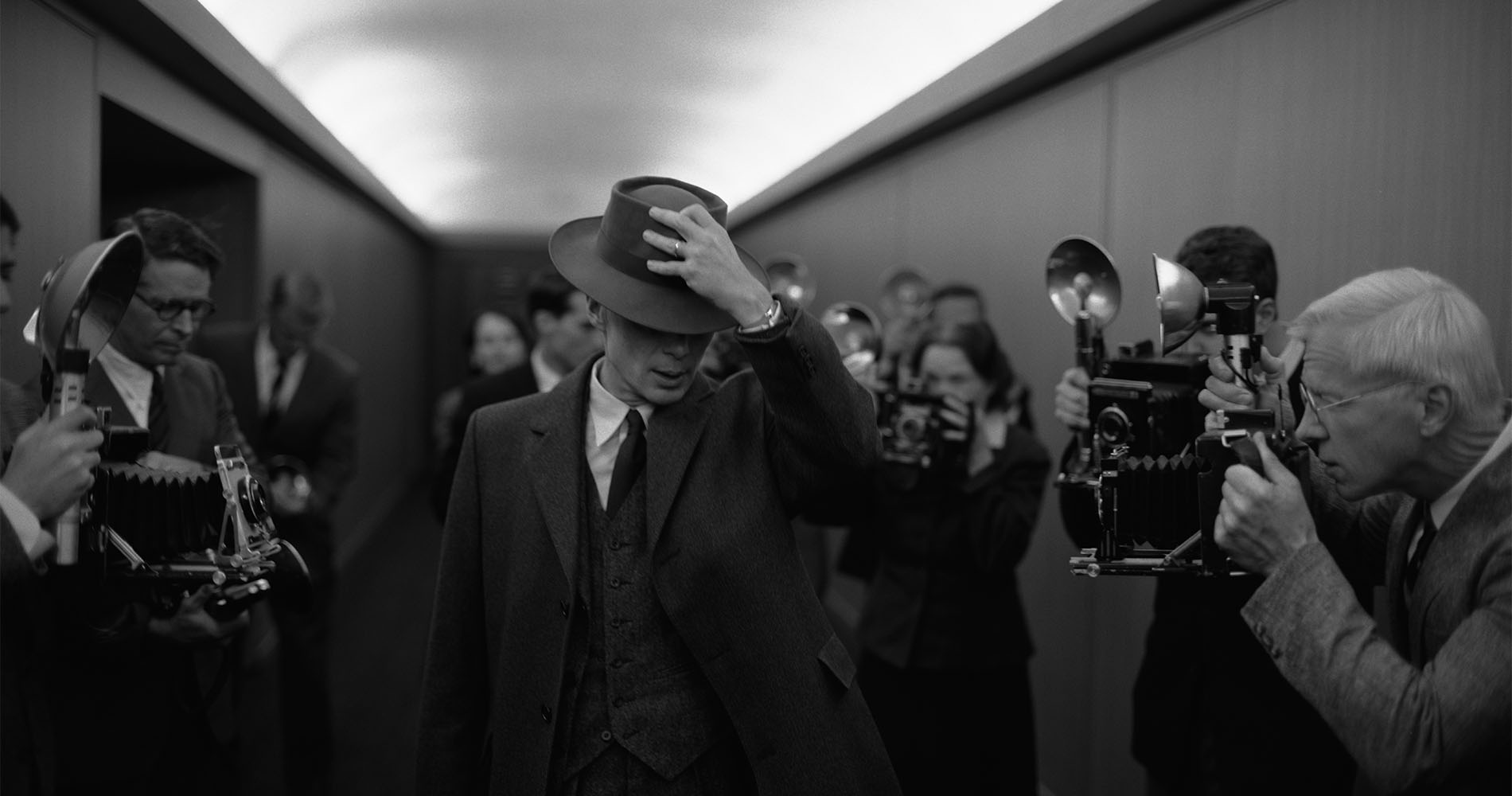Orange Is The New Black: Müssen wir „beide Seiten“ verstehen? [Spoiler]

Orange Is the New Black (OITNB) ist eine sozialkritische Netflix-Serie. Sie spielt in einem Frauengefängnis und inkludiert unterdrückte Identitäten, wie lesbische oder trans Frauen, erzählt auch die sozialen Widersprüche der USA. Ihr fehlt aber ein klarer Standpunkt, wie Staffel vier zeigt.
Während die „Black Lives Matter“-Bewegung in den USA ein Ende von rassistischen Polizeimorden fordert und dabei an Größe gewinnt, findet dieses Thema auch in der vierten Staffel der Netflix-Serie Orange Is the New Black Widerhall. Der soziale Kommentar der Serie lässt allerdings mehr als zu wünschen übrig: Die Darstellung des Mordes am lesbischen schwarzen Publikumsliebling Poussey Washington, gespielt von Samira Wiley, machte besonders schwarze Zuschauer*innen wütend.
Emotionalisierung durch Hintergrundgeschichten
Schon ab der Hälfte der Staffel wird ihr Tod vorbereitet: Die Jugend des Täters, ein Gefängniswärter, wird dargestellt. Er wird lieb, ja harmlos porträtiert, wie er als Teenie kifft und sich als einziger in seinem Freundeskreis nicht abfällig äußert, wenn seine Leute und er Insassinnen bei der Arbeit im Ort sehen. Während das Securitypersonal des Gefängnisses mit der Privatisierung in der dritten Staffel härter wird, bleibt er relativ freundlich und zurückhaltend.
Ein paar Folgen vor Staffelende erfahren wir dann auch mehr über Pousseys Hintergrund und wie sie in den Knast kam. Sie, eine unglaublich liebevolle junge Frau, die wegen einer skandalös geringen Menge Gras im Gefängnis landete, wird gezeigt, wie sie im New Yorker Nachtleben unterwegs ist, das erste Mal in einem LGBT*-Club feiert und sich mit Drag Queens anfreundet.
All diese Bilder werden vor der eigentlichen Tat gezeigt. Sie sollen dann eine möglichst starke emotionale Reaktion der Zuschauer*innen auslösen. Poussey wurde für die Story geopfert, weil sie den Tod am wenigsten von allen „verdient“ hat. Aber kein Schwarzer Mensch hat es „verdient“, von Bull*innen ermordet zu werden. Nicht für den Verkauf von CDs (Alton Sterling), nicht für das Tragen einer Spielzeugwaffe (Tamir Rice), nicht für ein kaputtes Rücklicht am Auto (Philando Castile), nicht für das Fahren unter Drogeneinfluss (Leroy Browning), nicht für das Tragen einer Kapuze (Trayvon Martin), nicht für den Besitz einer Waffe (Korryn Gaines). Was diese Fälle zeigen: Die Opfer mit ihren individuellen „Taten“ sind nicht schuld an ihrer Ermordung – Rassismus und strukturelle Polizeigewalt sind es.
Verständnis für Täter*innen
Weil Poussey nicht im rassistischen Verdacht der „eigenen Schuld“ steht, verfassten die Autor*innen ihren Tod. Mit ihr kann auch ein weißes, liberales Publikum mitfühlen, das nicht die Abschaffung der Polizei fordert. Hinzu kommt, dass ihr Tod ein Unfall ist. Der Wärter, dessen Hintergrund wir uns für mehrere Folgen schon angesehen haben, mit dem wir mitfühlen sollen, drückt sie in einer eskalierenden Situation in der Kantine des Gefängnisses auf den Boden. Gleichzeitig versucht er Suzanne abzuwehren. Poussey sagt, mit dem Bauch auf dem Boden liegend, mehrere Male, „I can’t breathe“, die Anlehnung an Eric Garners Worte, bevor er im Würgegriff eines Polizisten starb, ist eindeutig. „Was mich aufregt, ist, dass sie es nach einem Unfall haben aussehen lassen. Black Lives Matter kämpft nicht gegen Unfälle. Wogegen wir kämpfen, das ist beabsichtigte Polizeigewalt”, sagt der YouTuber CaptainKirk sehr treffend in seiner Kritik an der Serie. Auch reiht sich der Tod der Lesbe in das beliebte Narrativ ein, queere Rollen (vorallem queere Frauen), zur Repräsentation zu kreieren und sie dann zu opfern, weil Macher*innen denken, die Mehrheit der Zuschauer*innen hinge am wenigsten an ihnen.
Nicht nur in der Vorbereitung und Darstellung von Pousseys Tod wird klar, dass es den Macher*innen darum geht, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Auch im Fall von Pennsatucky, welche in der dritten Staffel von einem der Gefängniswärter vergewaltigt wird, kommt dieses Motiv zum Ausdruck. Der Täter wird gezeigt, wie er nette Dinge tut, und letztendlich kommt Pennsatucky ihm wieder näher und vergibt ihm. Niemand behauptet, dass Täter*innen nicht auch nette Dinge tun können. Doch entscheidend ist, dass von diesem Narrativ des „Verstehens beider Seiten“ nur eine profitiert: Die der Täter*innen.