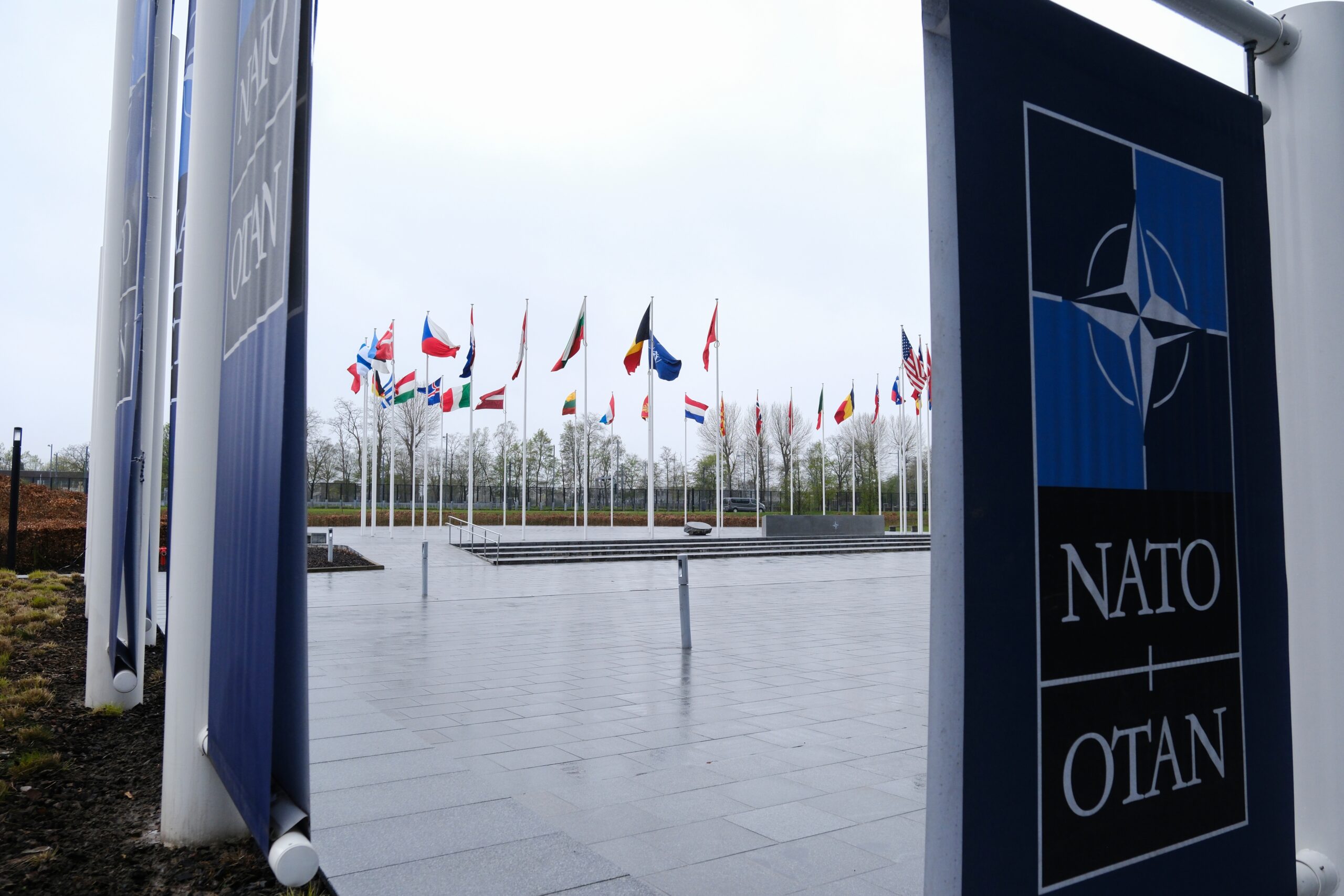Libertäre im US-Wahlkampf: Der Traum vom kleinen Staat

Das Rennen um die US-Präsidentschaft machen Hillary Clinton und Donald Trump unter sich aus. Doch neben ihnen positioniert sich der Kandidat der Libertären, Gary Johnson, als Alternative und wirbt um enttäuschte Sanders-Fans. Besser macht es ihn und seine Partei nicht.
Der Kandidat in Großaufnahme, holprige Rhetorik, langweiliges Gedudel im Hintergrund, dazwischen ungelenke Schnitte und unpassende Archivbilder. Es ist ein durchschnittliches Wahlkampfvideo einer Drittpartei, in dem Gary Johnson um Unterstützung wirbt. Interessant ist das adressierte Publikum: Der Präsidentschaftskandidat der Libertären Partei (LP) wendet sich explizit an von Hillary Clinton enttäuschte Unterstützer*innen von Bernhard Sanders. Genau wie „Bernie“ sei er gegen die Kriege, an denen Clinton beteiligt sei. Er lehne den „cronyism“, die Vetternwirtschaft, ebenso ab, wie Sanders. Auch in den Fragen der Legalisierung von Marihuana und der Bürger*innenrechte seien sie einer Meinung.
Was Johnson in dem Video indes nur kurz streift, ist der eigentliche Kern des libertären Programms. Seit ihrer Gründung 1971 ist die heute drittgrößte Partei der Vereinigten Staaten ein Hort für die Illusionen verbitterter Kleinbürger*innen. Für Johnson und die Libertären ist der Ursprung allen Übels das „big government“, der große Staat. Der ist für wirklich alles Böse und Schlechte in der Welt verantwortlich: zu hohe Steuern, zu viel Sozialstaat, zu viel Regulierung der Wirtschaft. Darin besteht aus ihrer Sicht der „cronyism“. Der Kapitalismus, wie sie ihn sich erträumen, ist die Rückkehr in eine Zeit, die es nie gegeben hat, in Modelle aus bürgerlichen Einführungslehrbüchern in die Wirtschaftswissenschaft. Auf große Unternehmensspenden kann Johnson trotzdem nicht bauen. Denn die Bosse verstehen, was den kleinbürgerlichen Libertären unverständlich ist: dass der Staat in ihrem Interesse handelt.
Diese Verbindung von härtester Austerität mit menschlichem Antlitz nennen sie „fiscally conservative, but socially liberal“, finanzpolitisch konservativ, aber sozial fortschrittlich. Mit der politischen Haltung von Bernie Sanders hat das freilich wenig zu tun. Doch Johnson nutzt, dass Sanders zum „Schäferhund“ der Demokratischen Partei geworden ist, um kritische Stimmen für Clinton zu gewinnen. Beide großen Parteien befinden sich in einer tiefgehenden Legitimitätskrise. Weil Sanders jetzt hinter Clinton steht, will Johnson die Unzufriedenheit besonders der Jugend aufsaugen. So präsentiert er sich als Kämpfer gegen den Staat vor den Augen derjenigen, die diffus etwas gegen „die da oben“ haben.
Johnsons Erbe als ehemaliger Gouverneur von New Mexico zeigt jedoch deutlich, was eine libertäre Präsidentschaft für Arbeiter*innen und Unterdrückten bedeuten würde. Zwischen 1995 und 2003 ging der damalige Republikaner daran, alles in seinem Staat zu privatisieren, was er in die Finger bekam. Als er das Amt wieder verließ, waren 44% der Gefängnisinsass*innen in privaten Gefängnissen untergebracht, die höchste Rate zu der Zeit im Vergleich aller Bundesstaaten. Auch Morde an Häftlingen und regelmäßige Menschenrechtsverletzungen änderten an diesen Plänen nichts. Die Löhne von Regierungsangestellten wurden in der Zeit eingefroren, der Mindestlohn ebenso, das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung griff er an, wann immer es ihm möglich war. Bill Clintons Angriff auf das ohnehin mickrige Sozialhilfesystem nahm Johnson zum Anlass, noch weiter zu gehen. Zehn Millionen Dollar strich er aus dem dafür eingeplanten Budget, die Anforderungen wurden noch schärfer. Kurze Zeit später lebten in New Mexico so viele Menschen in Armut wie in keinem anderen Staat. Seine Pläne für radikale Steuersenkungen für Reiche scheiterten weitgehend im legislativen Prozess. Bis er 1999 für die Legalisierung von Marihuana eintrat, war von seiner „progressiven Seite“ nichts zu sehen. Es gibt wenige Anzeichen, dass sich seine Ansichten seit seiner Amtszeit tatsächlich geändert haben.
Lange Zeit sah es so aus, als könnte ihm diese Scharade einen Platz neben Clinton und Trump auf der Bühne der Fernsehduelle einbringen. Die dafür nötigen fünfzehn Prozentpunkte in den Umfragen verfehlte er jedoch, weil er seinen Wahlkampf mit einigen Peinlichkeiten sabotierte: Angefangen bei seiner Ahnungslosigkeit darüber, wer oder was die belagerte syrische Stadt Aleppo ist, über die Unfähigkeit, eine*n einzige*n Politiker*in zu nennen, den*die er bewundert, bis hin zu einem mittleren Ausraster, als er seinen Steuerplan verteidigen sollte. So steht er statt bei acht oder neun inzwischen unter fünf Prozentpunkten. Der Hass auf Clinton und Trump ist groß in weiten Teilen der US-amerikanischen Gesellschaft. Doch wenn viele sagen #NotWithThem, dann bezieht sich das auch auf Gary Johnson.