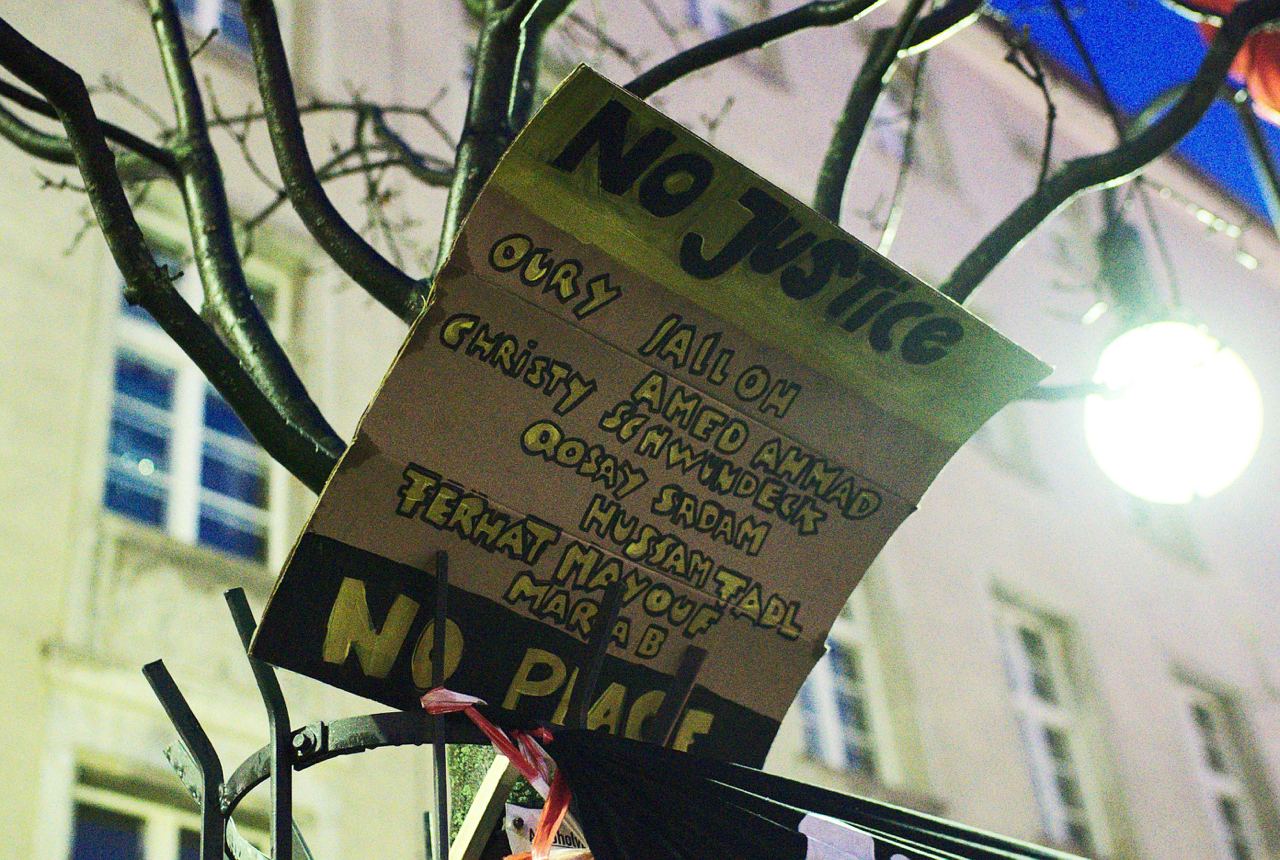Konsensprinzip oder Demokratie?

In den größten Protestbewegungen der letzten Jahre herrschte oft die Vorstellung vor, dass Entscheidungen nur durch das Finden eines Konsenses getroffen werden dürften. So geschah es bei weiten Teilen der Bildungsstreikbewegung, die ihren Höhepunkt im Herbst 2009 mit der Besetzung von 70 Hörsälen erreichten.
Diese Bewegung lähmte sich selbst durch das „Konsens-Prinzip“, weil stundenlange Plena der BesetzerInnen oft zu keinem wirklichen Konsens und damit zu keinen konkreten Ergebnissen kamen. Auch in vielen Versammlungen im Rahmen der Bewegung des 15. Mai, die seit Monaten auf den öffentlichen Plätzen im spanischen Staat stattfinden, verlor sich die Entscheidungskraft im Wunsch, gemeinsame Stärke durch von ausnahmslos allen getragenen Entscheidungen zum Ausdruck zu bringen. Konkret bedeutete dies aber, dass auf Versammlungen mit 10.000 oder mehr TeilnehmerInnen einige wenige Anwesende jegliche Entscheidung blockieren konnten.
Dieser Wunsch, ausschließlich auf der Grundlage eines Minimalkonsenses zu arbeiten, geht zurück auf die Vorstellung, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft am gleichen Strang ziehen und mehr oder weniger die gleichen Interessen haben würden. Doch sowohl bei der Bildungsstreikbewegung in Deutschland wie bei der 15M-Bewegung im Spanischen Staat kämpfen ArbeiterInnen und Jugendliche gegen die Interessen der KapitalistInnen und ihrer StandhalterInnen von den etablierten Parteien. Mit diesen anderen Klassen wird nie ein „Konsens“ zu finden sein, denn sie profitieren von den Zuständen, gegen die wir protestieren.
Durch das Konsensprinzip – welches verlangt, dass alle Versammelten einem Vorschlag zustimmen oder zumindest nicht blockieren, damit dieser angenommen wird – ist es für kleine Minderheiten (und sogar für Einzelpersonen) möglich, die Entscheidungen großer Mehrheiten zu blockieren. Diese großen Mehrheiten sind es aber, welche den Protest überhaupt tragen und möglich machen.
Wir als revolutionäre SozialistInnen, welche sich auf das theoretische Erbe Karl Marx‘ beziehen, wissen, dass diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen, gar nicht die gleichen Interessen haben können wie diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Um eine Veränderung der Produktionsverhältnisse zu erreichen, muss sich aber die arbeitende Mehrheit gegen die besitzende Minderheit durchsetzen (und auch den Staat zerschlagen, der diese Minderheit schützt).
Sollten wir bei öffentlichen Versammlungen diese Minderheiten, welche am Bestehenden festhalten, von vornherein ausschließen? Bei der Bildungsstreikbewegung gab es tatsächlich Fälle, wo Mitglieder der FDP aus den Versammlungen ausgeschlossen wurden, um ohne sie einen Konsens zu erreichen. Das ist aber alles andere als demokratisch. Wirkliche Demokratie verlangt, dass die Mehrheit einer Versammlung Entscheidungen treffen kann – wobei die Minderheit jederzeit das Recht behält, die Entscheidungen zu kritisieren und bei der nächsten Versammlung für andere Entscheidungen einzutreten.
Auch folgende widersprüchliche Absurdität wurde in der Bildungsstreikbewegung deutlich: Die Forderung, denjenigen einen besseren Zugang zur Bildung zu ermöglichen, die es von ihrer sozialen Herkunft (also der ökonomischen und akademischen Stellung der Eltern) schwerer haben – also die Forderung nach uneingeschränktem Zugang zur Hochschule – wurde durch das Konsensprinzip aus den Forderungskatalogen gedrängt. Fakt ist nämlich, dass diejenigen, die neben ihrem Studium für Lohn schuften müssen oder sich keine teuren Mieten in der Innenstadt in Uni-Nähe leisten können, keine Zeit haben, sich endlos langen Plena auszusetzen. Was also zuerst ultrademokratisch wirkt, erweist sich in Wirklichkeit als die Diktatur jener Minderheit, die am Längsten sitzen bleiben kann. Indirekt wurde das auch anerkannt, indem bei bestimmten besetzten Hörsälen der „Konsens“ zu einer „Etwa-Zwei-Drittel-Mehrheit“ oder ähnlichem umformuliert wurde. Auf dem besetzten Plaça de Catalunya in Barcelona wurde das Konsensprinzip nach einigen Wochen deswegen auch verworfen.
Es gibt aber eine demokratischere Alternative. Wir brauchen klare Strukturen, die von den Versammlungen gewählt werden und jederzeit rechenschaftspflichtig und abwählbar sind. Denn in jeder Bewegung entstehen Hierarchien: Das hat man gerade beim Bildungsstreik gesehen, wo letztendlich kleine Gruppen von „BerufsaktivistInnen“ die Bewegung dominierten. Die Wahl von Streikkomitees oder ähnlichen Strukturen ermöglicht eine permanente Kontrolle derjenigen, die für die Bewegung sprechen (und solche wird es immer geben, ob sie gewählt werden oder nicht). So kann man auch alle integrieren, die sich ernsthaft inhaltlich an Bewegungen beteiligen wollen, aber nicht sechs Stunden pro Tag für Versammlungen aufbringen können.
In den gegenwärtigen Verhältnissen sind wir marxistische RevolutionärInnen eine kleine Minderheit. Deshalb kommt es immer wieder zu Situationen, in denen unsere Argumente, mögen sie auch unserer Meinung nach noch so richtig sein, die Anderen nicht überzeugen. So müssen auch wir uns Mehrheitsentscheidungen fügen und die Umsetzung aller Resolutionen (kritisch) begleiten, um bei der nächsten Versammlung nochmal unsere Argumente einzubringen. Gerade die Erfahrung, getroffene Entscheidungen gemeinsam umzusetzen, ermöglicht Lernprozesse, in denen eine revolutionäre Perspektive ausgetestet werden kann.
Unser Anliegen ist es also, die Selbstorganisierung der Protestierenden in jeder Situation voranzutreiben. Nur demokratische Versammlungen sowie Strukturen, die direkt von ihnen gewählt werden, sollten für die Bewegung sprechen. Deswegen glauben wir nicht, dass Mitglieder von politischen Gruppen diskriminiert werden sollten, um eine eventuelle „Vereinnahmung“ zu verhindern, wie im Bildungsstreik schon mal vorgekommen ist. Gerade die Offenheit darüber, wer zu welcher Organisation gehört (und es gibt viele Mitglieder der JuSos oder der Grünen Jugend, die sich nicht als solche ausgeben!) ermöglicht Transparenz und demokratische Kontrolle.