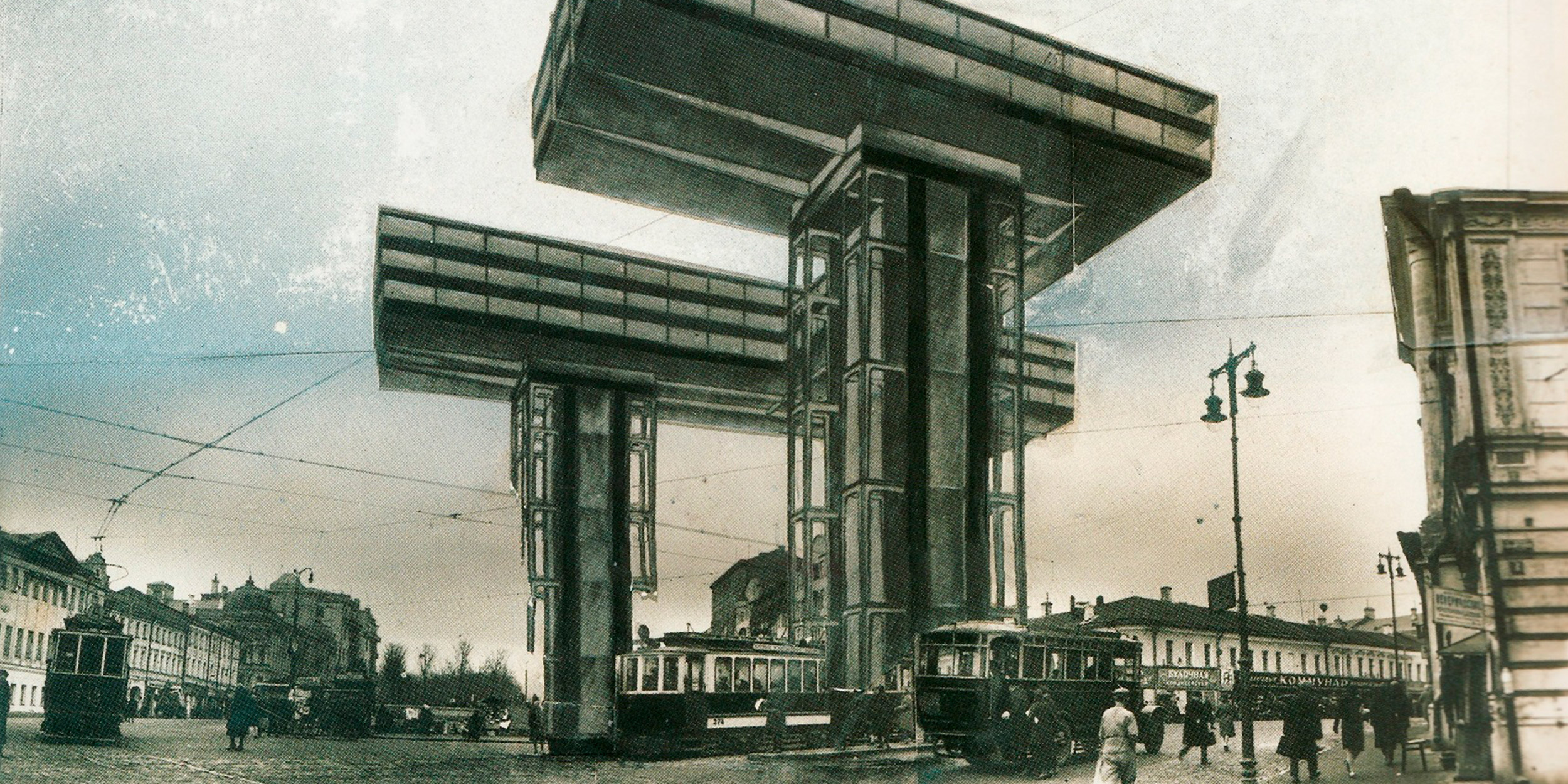Identitätspolitik: Selbstermächtigung oder ewiges Opfertum?

In Zeiten von Rechtsruck zu bemerken, dass die eigene Identität mit Diskriminerung behaftet ist, kann ein erster wichtiger Schritt Richtung Politisierung sein. Doch um erfolgreich Widerstand zu führen, darf man nicht auf der Ebene subjektiver Erfahrung stehen bleiben.
Als Identitätspolitik bezeichnet man eine Form von Politik, die sich nach den besonderen Bedürfnissen einer bestimmten, von der Gesellschaft marginalisierten sozialen Gruppe (Identität) richtet. Dazu gehören unter anderem Geschlecht, race, Sexualität, Dis/Ability, sowie ihre Intersektionen, also die „Mehrfachbetroffenheit.1“ Hier ist jedoch bereits anzumerken, dass Intersektionalität nach ihrer Begründerin Kimberle Crenshaw in erster Linie ein juristischer Ansatz war um die spezifische Diskriminierungserfahrungen von schwarzen Frauen gesetzlich behandeln zu können und die „Identität“ Klasse in Crenshaws Analyse selbst nur teilweise oder gar nicht vorkommt2.
Zwar gibt es nicht „die eine“ Identitätspolitik, doch ein Denominator ist die Politisierung der eigenen Identität, die zuvor lediglich der privaten Sphäre zugeordnet wurde3. Dem zugrunde liegen verschiedene Diskriminierungserfahrungen der „Betroffenen,“ deren Ursprung sie im gesellschaftlich dominierenden Diskurs, also in Verhalten und Sprache von Privilegierten, verorten. Die Privilegien-, bzw. Betroffenheitsskala orientiert sich dabei in der Regel am (alten) weißen Mann, der in der Gesellschaft die höchste Stellung genießt, während zum Beispiel Frauen, queere Menschen, behinderte Menschen oder People of Color, marginalisiert und unterdrückt werden. Aus diesen kollektivierten Erfahrungen wird eine Systematik hinter der Diskriminerung abgeleitet, wobei oft unklar bleibt, nach welchen Gesetzen sich diese Systematik verhält oder wo ihr Ursprung liegt. Crenshaw, zum Beispiel, geht so weit als zu sagen, dass die Menge an geteilten Erfahrungen von Frauen ein breit gefasstes Dominanzsystem erkennen lässt, das Frauen als eigene Klasse angreift („a broad-scale system of domination that affects women as a class“4), dabei aber außer Acht gelassen wird, dass gerade die Klassenzugehörigkeit zu widersprüchlichen Interessen führt.
Der Eindruck, die Mitglieder der Gesellschaft seien nicht gleichberechtigt, liegt in der Tat nicht fern. Mainstream Medien, Kultur und Forschung reflektieren kein wahrheitsgetreues Bild der Gesellschaft, sondern propagieren eine Idealvorstellung entsprechend herrschender Klasseninteressen. Dies ist besonders problematisch, denn die Institutionen oder Organe, durch die das geschieht, behaupten, im Namen der gesamten Gesellschaft oder einer sozialen Gruppe zu sprechen. Obwohl sich der Deutsche Staat zum Beispiel bedingungslos hinter Israels genozidale Politik stellt und die Tagesschau Palästinenser:innen kaum erwähnt, liegt eine Umfrage aus Januar vor, die angibt dass zwei Drittel der Deutschen die Unterstützung für Israel falsch finden. Ähnlich geht es vielen Studierenden, die sich von einseitigen Solidaritätsbekundungen mit Israel nicht vertreten fühlen. Dieser Mangel an Repräsentation, sei es in den Medien, der Politik oder der Universität, ist eines der Kernprobleme, das die Identitätspolitik beheben möchte.
Aufgrund der Breite ihrer Facetten ist Identitätspolitik ein vorherrschender Ansatz im Kampf gegen Unterdrückung, denn sie dient vielen Menschen, deren Leben von Ausgrenzungserfahrungen gezeichnet ist, als Ventil für ihre berechtigte Wut. Der Austausch über ähnlichen Erfahrungen bestätigt Betroffene in ihrer Wahrnehmung; in eigenen Communities fühlt man sich plötzlich verstanden und aufgehoben, entwickelt einen Stolz darüber anders zu sein, während das Anderssein vom Rest der Gesellschaft belacht, beschimpft, bekämpft wird. Die Selbstorganisierung im Interesse der eigenen Community ist begrüßenswert, denn es ist notwendig, dass alle Menschen in der Gesellschaft frei von Diskriminierung leben und ihre Interessen vertreten können.
Klassengesellschaft und Identität
Doch um dies tatsächlich bewerkstelligen zu können, muss Unterdrückung in ihrer Systematik verstanden werden, anstatt als Anhäufung von individuellen diskriminierenden Momenten oder bestimmten Begrifflichkeiten. Gerade weil die Existenz als Teil einer bestimmten Community im Alltag zu schmerzhaften, teilweise sogar lebensgefährdenden Begegnungen führen kann, ist es wichtig, die Wurzel dieser Erfahrungen zu begreifen und den Kampf entsprechend auszurichten. Denn obwohl der Name Identitätspolitik anders vermuten lässt, ist Unterdrückung nicht per se gewissen Identitäten (oder besser, sozialen Gruppen) angeboren, sei es am ausführenden oder erlebenden Ende, sondern entspringt der bürgerlichen Gesellschaft, deren Kern die kapitalistische Produktionsweise bildet.
Ohne dies anzuerkennen bleibt der Kampf im Kern individualistisch. Obwohl Menschen und ihre Ideen natürlich Einfluss auf Natur und Gesellschaft haben, wurde letztere doch erst durch menschliche Arbeit geschaffen, so notwendig bleibt es, dass wir Menschen im Kapitalismus auch als „Personifikation ökonomischer Kategorien,“ als „Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen“ betrachten5. Dadurch wird die Analyse systematisiert und hört auf „den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag“6.
Es ist die wahre Analyse der wirklich bestehenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die den Marxismus für die Bourgeoisie gefährlich macht, nicht Marx‘ Identität. Marx hat erkannt, dass eine Gesellschaft und ihr Bewusstsein, ihre Ideen, aus der jeweiligen Produktionsweise erwachsen. Wenn wir von der kapitalistischen Klassengesellschaft sprechen, dann bedeutet das, dass ein Teil der Menschen (meist die Mehrheit) überlebt, indem sie ihre Arbeitskraft als Ware verkauft (Arbeiter:innenklasse / Proletariat), während eine kleine Minderheit Produktionsmittel besitzt (Bourgeoisie / Kapitalistenklasse), Arbeitskraft kaufen und sich das fremde Arbeitsprodukt aneignen. Dieses Produkt verkaufen sie weiter und heimsen dabei Gewinn, oder Profit, ein, der jedoch nicht den Produzenten, den Arbeitern, zugutekommt. So werden diese um den von ihnen produzierten Mehrwert ausgebeutet. Darum diesen Mehrwert zu steigern, geht es den Kapitalist:innen. Die Spaltung der Arbeiter:innenklasse entlang Axen wie Geschlecht und Hautfarbe ist für sie dabei ein Mittel, um die Arbeitskraft bestimmter sozialer Gruppen zu entwerten und niedriger entlohnen zu können.
Das sehen wir zum Beispiel am Gender Pay Gap, den Hohnlöhnen in Behindertenwerkstätten, oder den „Arbeitsgelegenheiten“ im Rahmen des Asylbewerbergesetzes, wo Geflüchtete weniger als einen Euro Lohn bekommen. Es ist die Entwertung ihrer Arbeitskraft, die durch Rassismus und andere Formen von Unterdrückung ideologisch gerechtfertigt werden muss. Und es ist die Mehrarbeit, die Unterdrückte leisten müssen, die sie davon abhält, ihre „Identität“ in Freiheit ausleben zu können. Die Unfreiheit, samt all ihrer unterdrückerischen Ausprägungen, entstammt der Ausbeutung, und diese teilen sich alle Menschen, die von dem Verkauf ihrer Arbeitskraft leben.
Obwohl Anhänger der Identitätspolitik vorgeben, eben jene Spaltungen in der Gesellschaft überwinden zu wollen, bezweckt ihre Politik genau das Gegenteil, denn sie blendet gerade das entscheidende Merkmal (Klasse) aus, das die Spaltung verursacht. Kommt es doch vor, so nur in Form von Klassismus, also der Betroffenheit von Armutserfahrungen, der man sich also optional zugehörig fühlen kann. Dadurch wird dem Begriff „Klasse“ sein materieller Referent geraubt, es verschleiert die Tatsache, dass der Begriff in erster Linie die Stellung im kapitalistischen Produktionsprozess beschreibt, ganz gleich, ob man sich dieser nun bewusst ist oder nicht.
Indem sich Unterdrückung der Identitätspolitik nach nur auf subjektive Erfahrungen beschränkt, nimmt sie ihren Anhänger:innen auch die Möglichkeit, solch ein Klassenbewusstsein entwickeln und den rationalen Kern dieses Phänomens begreifen zu können. Vielmehr postuliert sie, dieser existiere überhaupt nicht. Das führt zu der Annahme, die gesellschaftlichen Bedingungen, die zu Unterdrückung führen, können nicht länger objektiv analysiert werden, sondern lediglich von denjenigen definiert werden, die sie erleben.
Aus dieser Logik entspringt auch die „Sprachrohr-Praxis,“ die große Teile der Identitätspolitik ausmacht. Da zum Beispiel nur People of Color Rassismus erfahren, sollen sie die einzigen sein, die über dieses Thema sprechen können. Doch aus der „Betroffenheit“ an sich springen nicht zwingend Expertise oder ein richtiges Programm gegen Unterdrückung. Auch die Popularität einer von „Betroffenen“ vertretenen Meinung oder Forderung ist nicht ausschlaggebend über die Richtigkeit. So wird beispielsweise in Teilen der linken Szene die Unterstützung für den Zionismus damit begründet, dass er eine angebliche Mehrheitsposition unter jüdischen Menschen in Deutschland sei. Selbst wenn dies so wäre, bietet der Zionismus trotzdem keine Befreiungsperspektive vom Antisemitismus, im Gegenteil, verschärft sich antisemitische Gewalt im Zuge der ständigen Gleichsetzung aller Juden:Jüdinnen mit dem israelischen Staat. Doch eben dadurch, dass allen „Betroffenen“ zugehört werden müsse, ganz gleich welches politische Programm sie vertreten, werden sie auf ihre Identität reduziert. Die Identitätspolitik bedient sich also jener Diskriminerung, die sie zu bekämpfen vorgibt.
Während Identität eigentlich als politische Axe der Selbstermächtigung dienen soll, kommen einige Formen der Identitätspolitik hinzu, die die Betroffenheitslogik dermaßen ausreizen, dass die Möglichkeit der eigenen Kampfkraft negiert wird. In diesen Fällen wird Identität als etwas strikt defizitäres aufgefasst7. Man selber habe keine Macht, denn diese liegt ja bei den privilegierten Teilen der Gesellschaft. Daher sollen letztere die ihnen gegebene Macht zugunsten der marginalisierten Gruppen einsetzen. Es werden Appelle an Privilegierte gestellt, sich zu reflektieren, Diskussionen werden abgeblockt, oder nur gegen ein Entgelt ausgeführt, da man keine unbezahlte Bildungs- oder Mehrarbeit mehr leisten wolle. Widersprüchlicherweise gehen sie aber dennoch von der Annahme aus, Privilegierte hätten aufgrund ihrer Erfahrungen kein ausgeprägtes Bewusstsein über Diskriminerung. Woher soll dann aber der Drang zur Reflexion und Selbstbildung kommen, wenn nicht durch den Austausch mit Betroffenen selbst?
Eine Theorie des Fortschritts?
Trotz der aufgezeigten Fehler der Identitätspolitik bedienen sich ihr viele Menschen, um über ihre Unterdrückungs- und Ausgrenzungserfahrungen reden zu können. Besonders an Universitäten wird sie als fortschrittlich verhandelt, denn sie gesteht unterdrückten Stimmen den Einzug in den akademischen Diskurs zu. Das ist jedoch nur insofern fortschrittlich, als wir annähmen, die wissenschaftliche Auseinandersetzung eines gesellschaftlichen Gegenstandes sollte nicht sowieso in Relation zu allen in der Gesellschaft vertretenen Menschen und Phänomenen geführt werden. Aus marxistischer Sicht ist dieser Ansatz kein Fortschritt, sondern lediglich ein lang überfälliges Korrektiv, wodurch der theoretische und ideelle Wissensstand lediglich die materielle Welt widerspiegeln würde. Und siehe da, für die bürgerlichen Gelehrten ist es fortschrittlich, dünkten sie doch bislang den Kolonisierten als Barbaren, die Frau als Mutter und Haushaltskraft, den Homosexuellen als psychisch Kranken, nicht aber als Menschen. Für uns jedoch ist es keine Neuigkeit, dass wir Teil der Gesellschaft sind, sei es in der kulturellen, politischen oder akademischen Sphäre.
In der letzteren gibt sich die Identitätspolitik mit der Kritik am Kanon (Selektion von Hauptwerken eines Studienganges) und teilweise auch mit Forderungen nach Nachteilsausgleichen zufrieden. Doch die hegemonialen Ideen, die der Kanon verkörpert, dominieren nicht weil sie besser sind, oder gar weil sie weißen männlichen Köpfen entspringen, sondern weil sie Ausdruck materieller Klasseninteressen sind. Doch auch postkoloniale Kritiker:innen deren Forschungsgegenstand subalterne Stimmen miteinbezieht, und daraus richtigerweise ableiten, dass die hegemoniale Wissenschaft – anders als es sein sollte – im Dienste der bestehenden Herrschaft steht und teilweise aktiv Teile der Gesellschaft unterdrückt, schaffen es nicht sich dem Kern dieser Tatsache anzunähern. Denn auch sie grenzen sich von marxistischen Methoden ab, allen voran von seiner Klassenanalyse.
Es ist die Abwesenheit der materiellen Realität in der Analyse der Identitätspolitik, die ihr bürgerliches Wesen entblößt. Denn wo die Ideen und Phänomene keinen Ursprung haben, können sie auch kein Ende haben. Laut der bürgerlichen Wissenschaft schwebt Unterdrückung wie ein Geist durch die Gesellschaft; mehr oder minder zufällig festigen die geisterhaften Ideen sich in den Köpfen der weißen Unterdrücker, und jagen, durch ihre weißen Körper zum Leben bemächtigt, mehr oder minder zufällig alle, die es nicht sind.
Sie verhandeln das Phänomen Unterdrückung auf zutiefst rückständige Art, erkennen es lediglich ideell an, ohne zeitgleich daraus das Ziel zu entwickeln, die Gesellschaft von dieser befreien zu wollen. Ohne materialistische Analyse können sie auch nicht zu einem anderen Schluss kommen, egal wie fortschrittlich ihre Rhetorik auch sein mag. Sie nehmen – ob gewollt oder ungewollt – hin, dass Unterdrückung auf Ewigkeit besteht. Identitätspolitik ist also weder fortschrittlich noch wissenschaftlich, denn sie untersucht Unterdrückung als eine diskursive Idee, geköpft von der Materie. Sie verleugnen somit den Klassenkampf als treibende Kraft der geschichtlichen Bewegung und als notwendige Grundlage der Überwindung aller Unterdrückungsformen.
Gegen Unterdrückung kämpfen – und gewinnen
Was passiert, wenn wir Unterdrückung unabhängig von den Produktionsverhältnissen betrachten? Unterdrückte soziale Gruppen werden wie eigene Klassen behandelt, die allein aufgrund ihrer Unterdrückung ein gemeinsames Interesse hätten. Das ist jedoch falsch, denn trotz der Unterdrückung, die sie im Kapitalismus erfahren, trennt sie ihre Klassenzugehörigkeit. Man muss sich bloß Annalena Baerbocks feministische Außenpolitik anschauen, die den Genozid in Gaza mit vorantreibt, um zu erkennen, dass das kein Feminismus ist, der die Gesamtheit der Frauen befreien kann, geschweige denn in der Lage ist, das Leben palästinensischer Frauen und Kinder zu gewähren.
Es ist also nicht die reine Betroffenheit, sondern der Klassenkampf, der auch innerhalb des Kampfes gegen Unterdrückung maßgeblich die Richtung vorgibt. Der rein ideelle Diskurs reduziert Unterdrückung zu einer moralischen Fehlentscheidung, was diejenigen, die tatsächlich zur Unterdrückung beitragen und von ihr profitieren (Bosse, Politiker:innen) entlastet, während zum Beispiel weiße Arbeiter und andere Unterdrückte, die gegen das gleiche System kämpfen, nicht aber die eigene Unterdrückungserfahrungen teilen, zum Feindbild auserkoren werden, obwohl auch sie durch die Ausbeutung keine in der Gesellschaft privilegierte Stellung einnehmen.
Praktisch äußert sich das in Forderungen nach Freiräumen oder Safe Spaces ausschließlich für People of Color, in denen Schutz vor Rassismuserfahrungen gewährt werden kann. Doch dies atomisiert und isoliert den identitätspolitischen Kampf gegen Rassismus, und lenkt ihn in Bahnen außerhalb gesellschaftlicher Wirksamkeit. Denn der Rückzug tastet weder die diskriminierenden Ideen noch das System, dem sie entspringen, an. Mehr noch, durch die Verschiebung des Feindbildes zum weißen Mann, die dem individualistischen Ansatz entspringt, werden dabei auch wichtige Schranken zwischen politischen Verbündeten errichtet. Der politische Kampf wird gebremst, teilweise sogar verunmöglicht.
Nur die Arbeiter:innenklasse schafft es, ein anderes gesellschaftliches System zu erkämpfen. Das bedeutet aber nicht, dass dies abseits vom Kampf gegen Unterdrückung passiert. Ganz im Gegenteil, Ausbeutung und Unterdrückung sind systemisch verknüpft und bedürfen einem geeinten Kampf. Das von der Identitätspolitik und bürgerlichen Wissenschaft propagierte Bild der Arbeiter:innenklasse als (weißes) Industrieproletariat ist ahistorisch und zeugt von Unkenntnis gegenüber der Terminologie, spielt jedoch ihrer spalterischen Funktion in die Hände. Dabei sind Unterdrückte mehrheitlich selbst Teil der Arbeiter:innenklasse. Unterdrückung zu bekämpfen ist also kein fremdes sondern durchaus ein der Arbeiter:innenklasse inhärentes Interesse, insbesondere wenn wir auf einer internationalen Skala denken.
Anstatt sich in isolierte Bubbles abzusondern, wo nur die eigene Opferklage widerhallt und irgendwann einfriert, müssen Unterdrückte ihre Forderungen überall in die Arbeiter:innenklasse, auch dann, wenn ihr Kampf dort noch nicht verankert ist und besonders dann, wenn er zunächst auf Widerstände und rassistische Vorurteile stößt, hinein tragen. Dort sind sie zuhauf repräsentiert, dort können sie Gehör erlangen, dort öffnet sich ihnen Tür und Tor zu gesellschaftlicher Macht. Jeder Arbeitskampf wird stärker, sobald er an der Seite der Unterdrückten steht, und jeder Erfolg gegen Unterdrückung greift das kapitalistische System als Ganzes an.
Im Umkehrschluss muss dieser Appell auch von den Arbeiter:innen selbst aufgenommen werden. In ihren Massenorganisationen, den Gewerkschaften, dürfen sie nicht nur für Lohnfragen streiken, wie es die bürokratischen Führungen vertreten, sondern müssen für eine Politisierung der Streiks kämpfen. Erst so können sie eine proletarische Hegemonie in den Massen verankern und ihre volle Kampfkraft entfalten.
Es ist allein die proletarische Solidarität, die der Gesellschaft den Weg in die Zukunft, den Sozialismus weisen kann. Wir sehen sie in den Hafenarbeiter:innen, die Waffenlieferungen nach Israel blockieren und so den anhaltenden Genozid angreifen; wir sehen sie in der feministischen Kampftradition rund um den 8. März, die im Jahr 1917 zur russischen Revolution führte. Wir sehen sie überall dort, wo wir nicht in bürgerlicher Manier die Augen vor der revolutionären Kraft der Arbeiter:innenklasse verschließen, sondern diese mit Forderungen im Interesse der gesamten Menschheit befeuern.
Fußnoten
Fußnoten
- 1. Ich setze „Betroffene“ in Anführungszeichen, da eine gewisse Identität nicht gleichbedeutend mit der Betroffenheit von diskriminierenden Erfahrungen sein muss.
- 2. Kimberle Crenshaw: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, in Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, S. 1244-45 JSTOR, https://doi.org/10.2307/1229039.
- 3. Kimberle Crenshaw: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, in Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, S. 1241 JSTOR, https://doi.org/10.2307/1229039.
- 4. Kimberle Crenshaw: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, in Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, S. 1241 JSTOR, https://doi.org/10.2307/1229039.
- 5. Karl Marx: Vorwort zur ersten Auflage. In: ML Werke,
- 6. Karl Marx: Vorwort zur ersten Auflage. In: ML Werke,
- 7. Kimberle Crenshaw: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, in Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, S. 1242 JSTOR