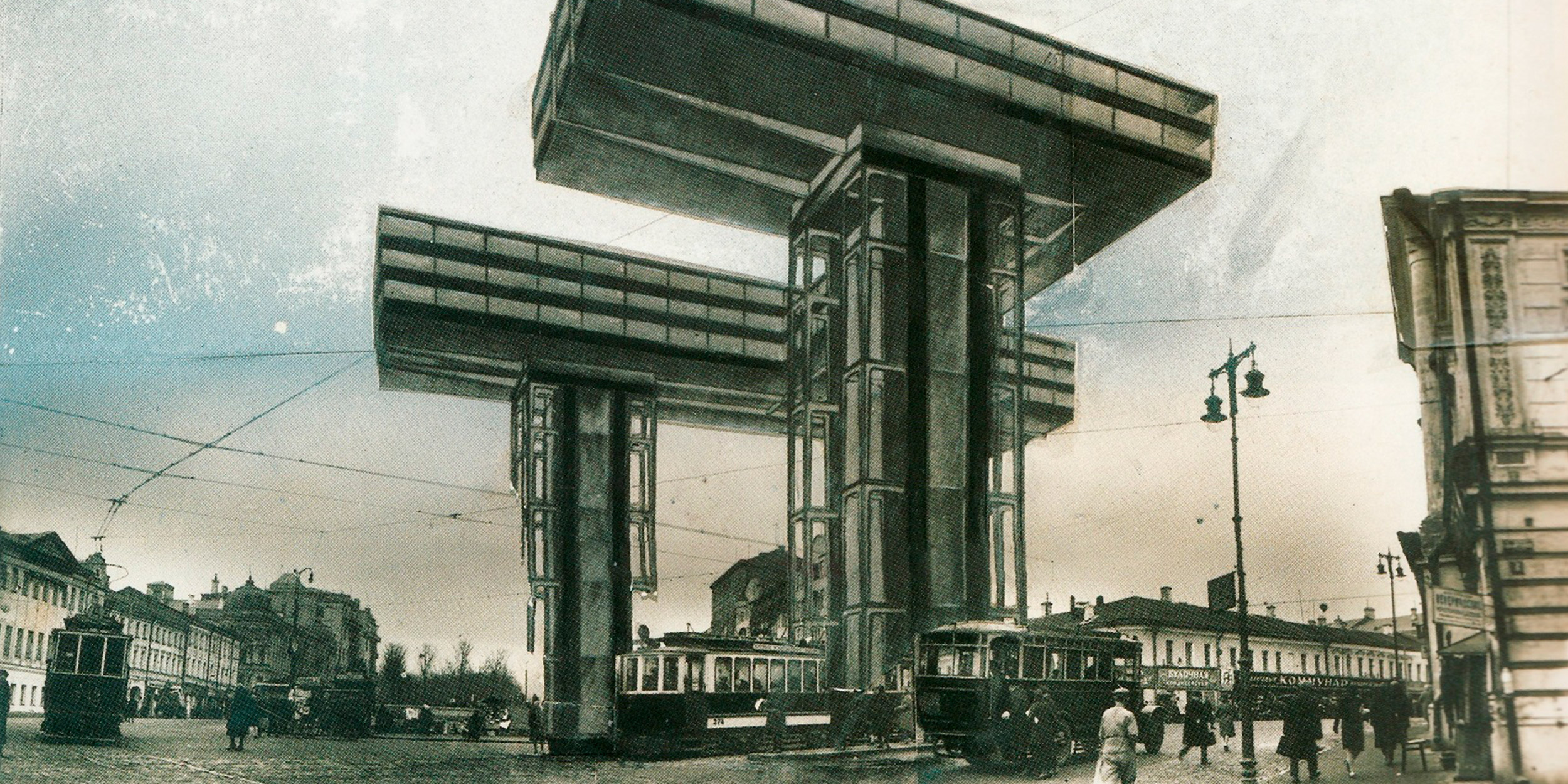Vermummt und verpixelt zur Revolution?

Viele Linksradikale in Deutschland wollen am liebsten gar nicht zu sehen sein. Sie vermummen und verpixeln sich sogar bei legalen Demos und Mobi-Aktionen. Doch was bedeutet Öffentlichkeit im Kampf gegen den Kapitalismus?
Zum ersten Mal habe ich 2009 erfahren, dass es mit Gesichtern auf Fotos überhaupt ein Problem geben kann. Wie in ganz Deutschland wurde in München im Bildungsstreik die Uni besetzt. Verpixelt kannte ich bis dahin nur Verdächtige im Fernsehen. Kämpfer*innen aus der Arbeiter*innenbewegung, die ich aus der Gewerkschaft kannte, verpixelte man nicht. Es gab gar keinen Grund dafür, einen legitimen Kampf ohne konkrete Gefahr zu verbergen.
Bei der Besetzung aber verpixelten Linke ihre eigenen Bilder und vermummten ihre Gesichter, während bürgerliche Journalist*innen fotografierten. Spätestens als die „Sportfreunde Stiller“ spielten, der Unipräsident zu einer Podiumsdiskussion ins besetzte Audimax kommen musste und tagein tagaus Presse da war, kam mir das Vermummen albern vor. Die Besetzung scheiterte – nicht nur in München, sondern deutschlandweit – schließlich nicht wegen Repression, sondern wegen der Isolation: weil immer weniger Leute kamen und die letzten sich in den Weihnachtsferien der Polizei ergeben mussten. Und keine einzige Person bekam wegen eines Bilds aus der Audimax-Besetzung München jemals Probleme.
Ein Problem der deutschen Linken
An den meisten Orten der Welt gibt es die Debatte um Verpixeln und Vermummen auf öffentlichen Versammlungen nicht. Als ein Genosse aus Argentinien von der Angst der deutschen Linken vor Bildern erfuhr, wunderte er sich: „Wenn sie nicht gesehen werden wollen, warum gehen sie dann auf die Straße?“ In seiner jahrelangen Tätigkeit als linker Journalist hatte er nie erlebt, wegen „unverpixelter“ Bilder von Demos angefeindet worden zu sein. Bis er 2016 nach Deutschland kam.
In Frankreich dasselbe: Die aktuelle Massenbewegung aus Jugendlichen und Arbeiter*innen gegen die Arbeitsmarktreform sucht die Öffentlichkeit – alle sind selbstverständlich in ihren Schulen und Unis bekannt, ihre Bilder stehen im Internet. Sie wollen die Mehrheit ihrer Klasse gegen das Arbeitsgesetz gewinnen. Beim Kampf gegen Repression spielt die Berichterstattung von Révolution Permanente eine wichtige Rolle, Videos über das Vorgehen der Polizei wurden Millionen Male geteilt.
Wir wollen ins politische Leben dieses Landes eingreifen. Wir wollen Gesichter gegen Rassismus, Krieg und Ausbeutung zeigen. Und wir wollen kollektive politische Antworten geben auf Angriffe, die uns von der herrschenden Klasse, ihrem Staat und den Faschist*innen im Kampf erwarten. Wir wollen vor den Augen unserer Klasse nicht wie Kriminelle aussehen – denn nichts anderes ist die Außenwirkung von Vermummten, die durch die Uni rennen, oder verpixelten Gesichtern, die ihre Forderungen per Bild transportieren wollen.
Auf die Spitze getrieben und bewusst eingesetzt wird das „Verbrecher*innen-Image“ vom deutschen Neo-Maoismus. Ihre Vermummung als Anspielung auf Befreiungsbewegungen in Halbkolonien ist völlig verfehlt, denn sie selbst leben in einem imperialistischen Land mit vielen demokratischen Privilegien und könnten damit Politik machen. Sie entscheiden sich aber, lieber nur Politik zu spielen.
Wenn es keinen entgegengesetzten konkreten Grund gibt, wie konkrete Entlassungsgefahr, delegitimiert eine Anonymisierung revolutionäre Politik nur vor den Augen der Massen. Sie lässt uns als einen Geheimbund erscheinen, als abgetrennt von den „normalen“ Studierenden, Schüler*innen, Arbeiter*innen. Das fällt nur innerhalb der radikalen Linken in Deutschland niemandem auf, weil sie in den Augen der Mitte der Klasse und sogar der Jugend sowieso alle als Geheimbünde aussehen – und oftmals sogar gern so aussehen wollen. Davon muss die Linke in Deutschland loskommen, wenn ihre Politik nicht nur ein Hobby sein soll.
Mit Versteckspielen wird nichts gewonnen
Linke politische Arbeit in Deutschland findet derzeit in einem relativ stabilen, bürgerlich-demokratischen und imperialistischen Land statt. Es ist in diesem Land eine Pflicht für linke Aktivist*innen, öffentlich für unsere Politik zu stehen und diese Privilegien zu nutzen. Freiwillig auf diese Privilegien zu verzichten, ist nichts anderes als eine verlängerte Wirkung des Chauvinismus.
Wir leben weder im Faschismus noch in einer bonapartistischen Diktatur. Das dürfen wir trotz aller Repression gegen linke Strukturen nicht vergessen. Es wäre ein Hohn auf die Arbeit von Revolutionär*innen in solchen Situationen, würden wir so tun als ob. Wir müssen unsere Privilegien nutzen – sei es die Erlaubnis, uns gewerkschaftlich und politisch zu organisieren, oder die Erlaubnis, öffentliche Agitation und Propaganda zu machen. Wenn wir alles verpixeln, werfen wir die Privilegien ungenutzt weg.
Mit der autonomen Versteck-Haltung ist ein starker Individualismus verbunden: Die Repression sei davon abhängig, ob ich als Einzelperson ausreichend geschützt werde – als ob man sich durch Geheimnistuerei schützen könne.
Aber was bedeutet Sicherheit konkret – und für wen? Eine Isolation der Linken gibt Sicherheit vor allem für Kapital, Staat und Rechte. Nichts anderes bedeutet das generelle Versteckspiel. Natürlich schützen wir konkrete Personen vor konkretem Erkanntwerden bei konkreten Gefahren, die definiert und abgewägt werden können – wie direkte Entlassungsgefahr oder konkrete juristische und rechte Bedrohungsszenarien. Bei Blockaden und illegalen Aktionen machen wir natürlich keine Bilder von Gesichtern, das wäre einfach dumm und würde unseren Feind*innen im Staat Waffen in die Hand geben.
Aber es ist eine ebenfalls dumme und gefährliche Illusion, zu glauben, dass man relevante und dauerhafte Politik machen und gleichzeitig unerkannt bleiben könne. Die höchste Form der Sicherheit in der bürgerlichen Demokratie ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Gerade der Fall der aktuellen Bewegung in Frankreich beweist, dass die Repression seitens der herrschenden Klasse dann in Frage gestellt wird, wenn sie öffentlich wird. Auch bei Schulstreiks hierzulande gibt es keine völlige „Sicherheit“, dass Schüler*innen keinen Ärger kriegen – das offene Übertreten des Legalismus ist gerade Teil dieser Aktionsform! Es gibt aber durchaus Waffen: Eine davon ist, dass wir Repression öffentlich skandalisieren und kollektiv beantworten.
Bilder sind Mittel des Kampfes
Nichts gibt es geschenkt im Klassenkampf und Abkürzungen gibt es auch nicht. Öffentlichkeit ist ein Zeichen der Ernsthaftigkeit: Ja, wer an einem Streik teilnimmt, kann Ärger dafür bekommen. Wir werben politisch dafür, dieses Risiko einzugehen, weil es sich lohnt. Wir verschleiern das nicht, wie die Autonomen es mit ihrer Mischung aus Paranoia und Illegalitätskult tun. Wir sind auch nicht der Ansicht, dass Repression eine individuelle Frage ist. Sondern wir – Linke und Arbeiter*innen – verteidigen uns kollektiv gegen Angriffe auf unsere legitime politische Organisierung, mit dem Prinzip der Solidarität.
Die Bilder sind Mittel unseres Kampfes, keine Nebenprodukte. Sichtbar wird das spannenderweise gerade bei Kämpfen derjenigen, die der größten Repression ausgesetzt sind: Immer, wenn Geflüchtete in den letzten Jahren Aktionen durchführten – Protestmärsche, Hungerstreiks, Besetzungen –, taten sie das in Mitten der Öffentlichkeit. Die Geflüchteten müssen die Isolation durchbrechen! Sie verlangen eine Berichterstattung! Mit KlasseGegenKlasse.org wollen wir zu dieser Berichterstattung beitragen. Es ist stets der erste Schritt für einen Kampf, eine Erklärung öffentlich zu verlesen, laut zu sagen, was ist.
Das Gleiche gilt für Kämpfe der antirassistischen Jugend. Die bürgerlichen Medien machen nur eine partielle Berichterstattung, die nie alle unsere Ziele wiederzugeben versucht. Unsere Website soll ein Sprachrohr sein. Für den antirassistischen Kampf, um Menschen zu überzeugen, was wir wollen. Dazu brauchen wir öffentliche Figuren unserer Politik, und kein Versteckspiel.
Auch an der Münchner LMU im Kampf gegen die AfD ist die Öffentlichkeit unser Mittel: Wir wollen keine Geheimtagungen von Pseudoparlamenten! Wir konnten durch Videoberichterstattung nicht nur die Legitimität des zahlreichen Widerstands dort aufzeigen, sondern zum Beispiel auch die skandalösen Methoden der Bürokratie, die immer die Öffentlichkeit fürchtet.
Nicht zuletzt gilt dieses Prinzip auch in den Kämpfen unserer Klasse. Gerade, wenn die Gewerkschaftsbürokratie nicht auf der Seite der kämpferischen Arbeiter*innen steht und sie angegriffen werden, brauchen sie öffentliche Solidarität. Wir – und andere klassenkämpferische Medien wie LabourNet – verbreiten solche Arbeiter*innenkämpfe. Und wir schaffen die Verbindung mit anderen Aktivist*innen, die erst so von diesen Kampferfahrungen hören.
Mit all dem soll nicht gesagt sein, dass es in Deutschland keine staatliche Repression und keine rechten Angriffe gäbe – im Gegenteil steigen beide Ziffern immer steiler an. Doch in den allermeisten Fällen ist – wenn wir tatsächlich über den Tellerrand der linken Szene hinaus kommen wollen – die Öffentlichkeit Teil der Stärke unserer Politik.