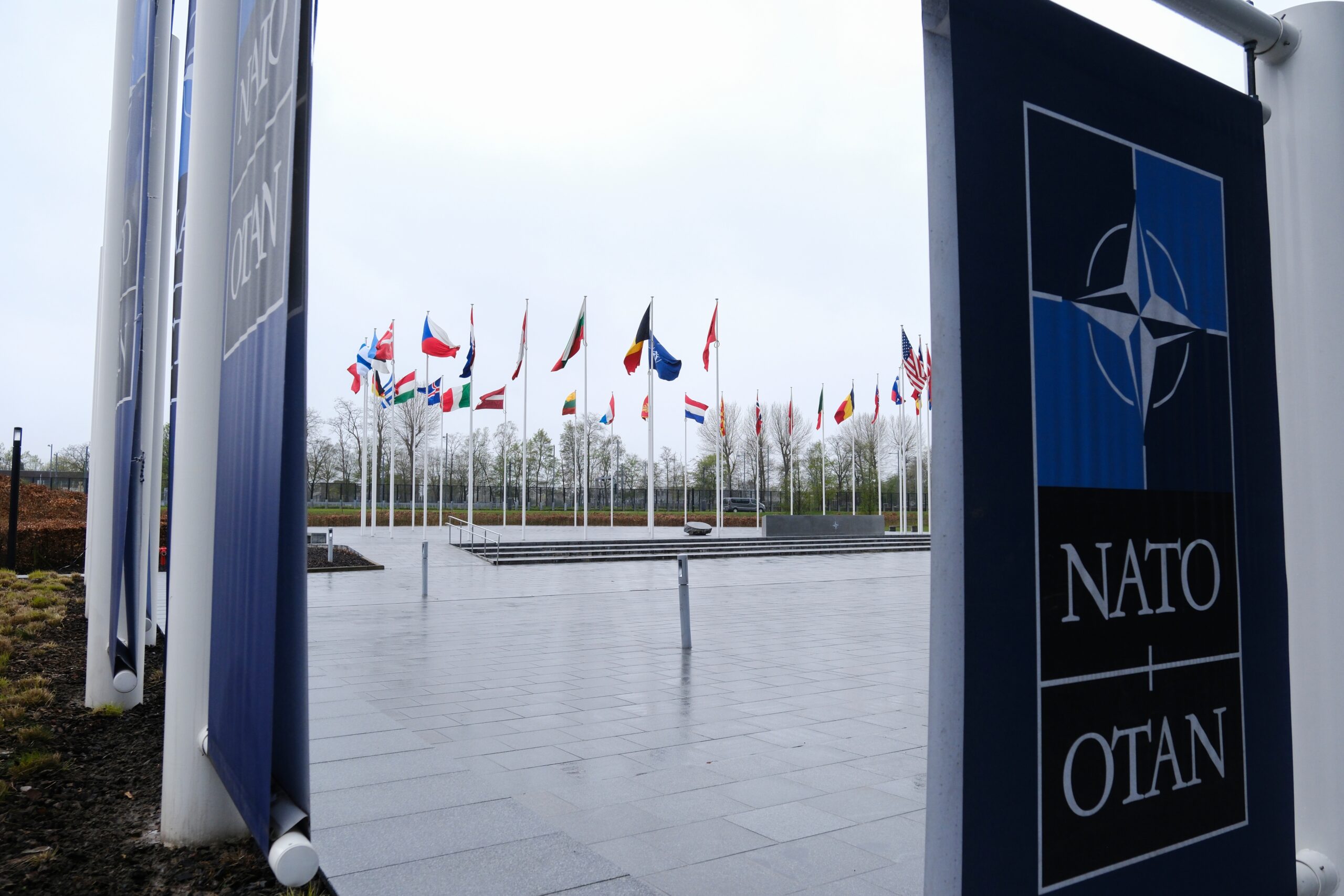Venezuela: Zwei-Tage-Woche und 30% mehr Lohn – ein Paradies für Arbeiter*innen?

Es klingt wie ein Traum: Die Regierung im Karibikstaat Venezuela erließ diese Woche ein Gesetz, dass die Arbeitswoche im öffentlichen Dienst auf zwei Tage begrenzt. Und eine 30-prozentige Lohnerhöhung gibt es auch noch. All das sind jedoch keine Indizien des Wohlstands, sondern der Krise eines zutiefst abhängigen Landes. Doch die junge Welt verteidigt das bonapartistische Regime weiter.
Die venezolanische Regierung von Nicolás Maduro hat in den letzten Wochen eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um einer neuen Wirtschaftskrise entgegenzutreten. Um den Strom- und Wasserverbrauch zu verringern, wurde die Arbeitswoche für Beschäftigte im öffentlichen Dienst verkürzt und die Arbeitszeit verringert. Die Schulen bleiben Freitags geschlossen und Supermärkte schließen früher. Zu Ostern wurden nicht nur zwei Tage, sondern die gesamte Woche zu Feiertagen erklärt. Dazu kommen mehrere Stunden Wasser- und Stromsperrungen jeden Tag.
Grund ist eine brutale Hitze- und Dürrewelle, die die Stauseen austrocknen lässt und damit die wichtigste Energiequelle bedroht: die Wasserkraft. Besonders betroffen ist der Guri-Stausee, der zu den größten Stauseen der Welt gehört. Er alleine ist für mehr als ein Drittel der nationalen Stromproduktion zuständig. Doch bei gleichbleibendem Klima müssten einige der Turbinen demnächst abgeschaltet werden, weil der Wasserpegel so niedrig ist.
Die Regierung will diese Energiekrise dem Naturphänomen „El Niño“ zuschreiben. Auch ihre Unterstützer*innen in Deutschland, wie die junge Welt, sehen die Schuld vor allem auf Seiten des Wetters. Doch die eigentliche Schuld liegt bei der Regierung, wegen der fehlenden Investition in andere Energiequellen. Während der Jahre des Ölbooms gab die Regierung von Hugo Chávez im Namen des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ Milliarden für die Bezahlung der Auslandsschulden aus.
Die Bevölkerung wurde durch gewisse Almosen indirekt an den Gewinnen aus dem Ölgeschäft beteiligt. Doch das grundlegende Problem des Landes – die fehlende Industrialisierung, mangelnde Infrastruktur und komplette Abhängigkeit vom Ölexport – wurde nicht aufgehoben. So kommt es dazu, dass mehr als zwei Drittel des gesamten Strombedarfs nur durch Wasserkraftwerke erzeugt werden. All das ignoriert die junge Welt in ihrer „Solidaritätskampagne“ mit Maduro.
Der Verfall des Ölpreises hat zu einer Vertiefung der schon drei Jahre andauernden Wirtschaftskrise in Venezuela geführt. Die Inflation erreicht auf das Jahr hochgerechnet 800 Prozent. Die Schlangen vor den leeren Supermärkten werden immer länger. Die Mischung aus Entlassungen in Staatsbetrieben, der kürzlichen Entwertung der Währung Bolívar und eine massive Benzinpreiserhöhung verstärken das Elend. Die Mindestlohnerhöhung von 30 Prozent reicht damit nicht annähernd, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu stillen.
Dazu kommt eine enorme politische Krise, die das Land Seit Ende vergangenen Jahres in Atem hält. Damals siegte bei den Parlamentswahlen die neoliberale Rechte, die nun Maduro lieber heute als morgen aus dem Amt werfen will. Während einige Sektoren auf den Rücktritt des Präsidenten warten, sammelten die Gruppen im größten Oppositionsbündnis MUD mehr als eine Million Unterschriften gegen den Präsidenten. Damit wollen sie ein Abwahlreferendum einleiten – bereits Ende des Jahres müsste sich Maduro über Wahlen bestätigen lassen. Doch der Oberste Gerichtshof blockiert die vom Parlament beschlossenen Gesetze, während das Parlament seinerseits erklärt, dass es den Entscheidungen des Gerichtshofes nicht mehr Folge leisten wird.
Diese Zuspitzung der politischen Krise – ein Machtkampf zwischen der neoliberalen Rechten und der linkspopulistischen Regierung – wird vom Imperialismus knallhart ausgenutzt. Präsident Obama selbst hatte vor wenigen Wochen seine Hoffnungen für einen Regierungswechsel ausgedrückt, wenig später verlängerte der US-Kongress die Sanktionen gegen Venezuela bis 2019. Die Washington Post fordert eine „politische Intervention“. Leidtragender dieses politischen Interessenkonfliktes ist die arbeitende Bevölkerung Venezuelas.
Die Maduro-Regierung, der Chavismus im Niedergang, lässt nichts als Krisen und Elend für die Bevölkerung übrig. Der Imperialismus und die lokale Rechte wittert ihre Chance. Für die Arbeiter*innen und verarmten Massen bleibt nur die unabhängige Mobilisierung, wenn sie sich vor dem weiteren Aufstieg der neoliberalen Rechten in Lateinamerika schützen wollen. Wie wenig das von der jW gepredigte Vertrauen in die linkspopulistischen Regierungen hilft, kann man aktuell in Argentinien oder Brasilien beobachten.